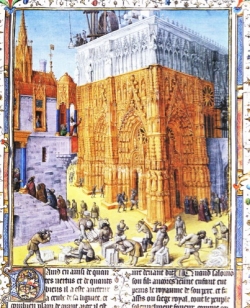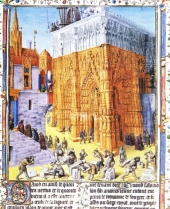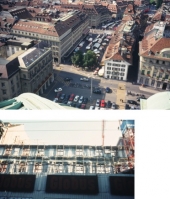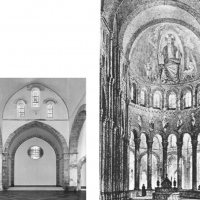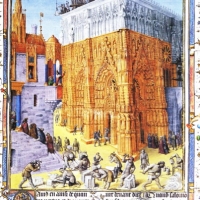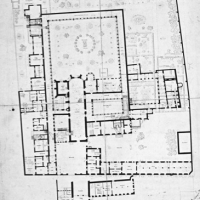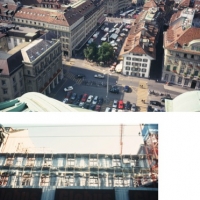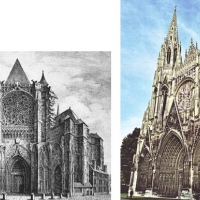Ethik der Denkmalpflege
I. Was ist und wozu dient Ethik?
Ethik ist eine praxisbezogene Abteilung der Philosophie. Sie will lehren, was wir für das Gemeinwohl tun sollen. Wenn man heute von Unternehmensethik spricht, wissen wir freilich nicht, ob es sich um ernsthaftes Nachdenken und ehrliches Bemühen handelt oder nur um ein moralisches Mäntelchen, das die Blößen des Firmenegoismus deckt. Die ins Leere gesprochene, von Vereinigungen und an Hochschulen gepredigte Wirtschaftsethik eignet sich vortrefflich zur heuchlerischen Besserwisserei und zur moralischen Entrüstung
Die Ethik der Denkmalpflege, wie ich sie verstehe, bezweckt etwas anderes. Sie entspricht dem, was sich die Experten und die Studienleitung dachten, als sie 1996 im Grundkurs für das Masterstudium Denkmalpflege und Umnutzung einige Lektionen Ethik festschrieben.
Wir wünschen uns, dass sich die Studierenden in diesem Masterstudium eine breite Fachkompetenz erwerben, die sie nicht nur befähigt, in Sachen Denkmalpflege richtig zu entscheiden, sondern auch mit anderen Fachleuten zusammenzuarbeiten und gemeinsam Probleme zu lösen. Ebenso geht es aber darum, die Sache der Denkmalpflege gegenüber anderen Anliegen der Gesellschaft und gegenüber anderen Aufgaben der öffentlichen Hand in einem fairen Dialog zu vertreten. Die Ethik der Denkmalpflege stellt diese Sache der Denkmalpflege zunächst in einen größeren Zusammenhang von Denk- und Verhaltensmustern und kann dazu anleiten, sich in der Öffentlichkeit oder in einer Geschäftsbeziehung zum Anwalt der Denkmäler zu machen. Die Lektionen zur Ethik wollen den Dialog mit anders Motivierten und anders Denkenden erleichtern. Sie wollen Argumente für sachliche Argumentation bieten. Sie wollen die Überzeugungen und Überlegungen ordnen helfen, die zum Studium in Burgdorf motivieren.
Bei der Eröffnung unseres Studiengangs Denkmalpflege im April 1997 habe ich ungefähr das Folgende ausgeführt:
Gesprächsführung, mündlicher Vortrag, schriftliches Gutachten, Texte für die Presse: sie alle haben ihre erlernbaren Techniken, die weit über das hinausgehen, was Mittelschulen unterrichten können und was ein Hochschulstudium zu lehren vermag, das zur Tätigkeit auf dem Problemfeld „Die gebaute Schweiz“ hinführt. Sie tauchen deshalb quer durch unseren Studienführer als Lehrinhalte auf, und zwar unter Begriffen wie „Argumentieren“, „Diskutieren“, „Darstellen“, „Führungen abhalten“ oder „Gutachten verfassen“.
In diesen Aufgaben steht man oft Menschen mit großem Bildungsgepäck, wohlgeordnetem Wissen und ausgebildeter Argumentationsfähigkeit gegenüber. In den fünf Lektionen zur Ethik der Denkmalpflege sehe ich meinen Auftrag darin, Denkstrukturen und Orientierungswissen vorzustellen, das zu Bausteinen der persönlichen Kompetenz im Denken, Sprechen und Schreiben dienen kann.
Meine Lektionen sind nicht die eines geschulten Philosophen, sondern die eines Kunst- und Architekturhistorikers, der gerne am Beispiel argumentiert.
Was ist Ethik? Ethik ist eine der Disziplinen der Philosophie, die auf Deutsch „Liebe zur Weisheit“ heißt. Ein anderer Ausdruck für Ethik ist Moralphilosophie, ein dritter Sittenlehre. Einer der berühmtesten Philosophen der Neuzeit, der um 1800 im damals deutschen Königsberg in Ostpreußen lehrende Immanuel Kant, umreißt die Aufgaben der Philosophie mit folgenden Fragen:
— Wer bin ich?
— Was kann ich wissen?
— Was soll ich tun?
Die letzte Frage, „Was soll ich tun?“, wird in der Disziplin der Ethik behandelt. „Kategorischer Imperativ“ heißt bei Kant das Sittengesetz, insofern es unabhängig von jeder Rücksicht auf Nutzen oder Vergnügen gebietet oder verbietet. (1)
Das Konversationslexikon meiner Großeltern, der Jubiläumsbrockhaus von 1909, sagt dazu unter dem seither veralteten Stichwort „Sollen“: (2)
Sollen, an sich der Ausdruck des Gebots überhaupt; in der Ethik in engerer Bedeutung das unbedingte Gebot des Sittengesetzes. Kant unterscheidet das kategorische vom hypothetischen Sollen (den kategorischen vom hypothetischen Imperativ). Ein hypothetisches (d. h. bedingtes) Sollen ist dasjenige, welches bloß vorschreibt, so zu handeln, wofern man bestimmte Folgen erreichen oder vermeiden will; kategorisch dagegen das, das nicht um der Folgen willen, sondern schlechthin gebietet. Von solcher Art ist nach Kant einzig und allein das sittliche Gebot, daher der kategorische Imperativ sich deckt mit dem Imperativ des Sittengesetzes oder der Pflicht.
Berühmt ist die Zusammenfassung, die Immanuel Kant in dem folgenden Satz gegeben hat:
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.
Das aus der französischen Moralphilosophie übernommene Fremdwort „Maxime“ kann man dabei durch „Richtlinie“ übersetzen.
Kant hat dieses ethische Prinzip oder Sittengesetz mehrfach ähnlich formuliert. Es ist einzusehen, dass darunter nicht rein altruistisches Handeln zu verstehen ist, sondern dass darin ein wenig Egoismus Platz finden darf, nicht nur durch die Grenzen der Selbstzerstörung, sondern auch durch Entschädigungen wie Zufriedenheit mit sich selbst, Anerkennung durch die Gesellschaft oder Belohnung nach dem Tod. Die Selbstaufopferung aller Menschen kann kein Naturgesetz sein.
Die Formulierungen Kants sind sehr abstrakt, ja weltfremd; inhaltlich aber unterscheidet sich sein kategorischer Imperativ kaum von den Grundsätzen aus religiösen Offenbarungen und philosophischen Weisheitslehren. (3) Ich führe einige davon auf: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füge keinem andern zu“, oder lateinisch: „ Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris.“ (4) Etwas stärker noch: „Neminem laede, immo omnes, quantum potes, iuva“, zu Deutsch: „Schade niemandem, sondern hilf, soviel du kannst.“ Im Buch Levitikus des Alten Testaments (d. h. im 3. Buch des Moses, 19, 18) heißt das im Neuen Testament vielfach wiederholte Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (5) Auch in der Existenzphilosophie Martin Heideggers gehört das „Mitsein“ zur Struktur des In-der-Welt-Seins; wir sind immer schon mit dem Anderen da; ihm gilt die „Fürsorge“. (6)
Immanuel Kant unterscheidet zwischen der empirischen und der intelligiblen Welt, zwischen der Welt der Erfahrung und der Welt der Ideen. Der kategorische Imperativ gehört zur Welt der Ideen, des bloß Denkbaren. Deshalb kann er keine Richtschnur für das Handeln selbst sein, sondern dient lediglich als Richtschnur für die Beurteilung des Handelns. Das muss schon deshalb so sein, weil es keine Freiheit des Handelns gibt, sondern allein eine Freiheit des Denkens. Darin stimmen zwar nicht alle, aber doch viele Religionen und Philosophien überein. Moderne Forschung glaubt sogar nachweisen zu können, dass das Bewusstsein die Handlungen nicht steuert, sondern sie nur registriert. (7)
Das war, als kausale Abfolge, schon Arthur Schopenhauer klar, der sich 1839–1840 in seinen Studien (8) über die Freiheit des menschlichen Willens und über das Fundament der Moral mit der Freiheitslehre Kants und der Philosophen des Idealismus auseinandersetzte. Nach Schopenhauers Formulierung liegt „der Wille vor dem Selbstbewusstsein“ (so eine Hauptüberschrift). „Wir können“, sagt der Volksmund, und Schopenhauer gibt ihm recht, „tun, was wir wollen“, doch damit ist nicht gesagt, dass der Wille frei ist. Leicht verwechselt man Wünschen mit Wollen; das Wollen zeigt sich Dritten, aber auch dem Selbstbewusstsein zuallererst in der Tat. Das Wollen ist eine Folge von Motiven, es unterliegt wie die ganze empirische oder Erfahrungswelt, der Kausalität.
Diese Motive sind nicht mit bloßen Reizen zu verwechseln, die Instinkte auslösen, sondern sind Gedanken, die auf Begriffen beruhen, die den Menschen vom Eindruck der Gegenwart unabhängig machen. Sein Tun, auch das geringste, ist deshalb, nach Schopenhauer, vorsätzlich und absichtlich. (9) Die Motive können Gegenstand der Überlegung sein, ja miteinander in Konflikt treten und zur Unentschlossenheit führen. Die Motivation „ist nicht im Wesentlichen von der Kausalität verschieden, sondern nur eine Art derselben, nämlich die durch das Medium der Erkenntnis hindurchgehende Kausalität“. Durch den Charakter „ist die Wirkung der verschiedenartigen Motive auf den gegebenen Menschen bestimmt“. Nach Schopenhauer ist der Charakter individuell, empirisch und konstant. Er ist angeboren, und mit ihm die Tugenden und die Laster. „Der Mensch ändert sich nie.“ Und weiter: „An dem, was wir tun, erkennen wir, was wir sind.“
Doch Schopenhauer entlässt den Menschen nicht aus der Verantwortung. Er nennt das Gefühl der Verantwortlichkeit eine Tatsache des Bewusstseins. Es gebe, schreibt er, „ein völlig deutliches und sicheres Gefühl der Verantwortlichkeit für das, was wir tun, der Zurechnungsfähigkeit für unsere Handlungen, beruhend auf der unerschütterlichen Gewissheit, dass wir selbst die Täter unserer Taten sind“.
Im Gegensatz zu Kant behauptet Schopenhauer: „[…] moralische Gesetze, unabhängig von menschlicher Satzung, Staatseinrichtung oder Religionslehre, dürfen ohne Beweis nicht als vorhanden angenommen werden.“ Es gelingt ihm zu zeigen, dass Kant nur die traditionelle Moraltheologie auf den Kopf gestellt hat, wenn er aus der Sittenlehre einen Gottesbeweis ableitet. (10) Der moralische Wert einer Handlung liegt bei Kant in der Maxime, die man befolgt, bei Schopenhauer in der Absicht, in der sie geschieht.
Er unterscheidet deshalb „zwischen der Gerechtigkeit, welche die Menschen ausüben, und der ächten Redlichkeit des Herzens“. Gerechtes Handeln unter religiösem, staatlichem oder gesellschaftlichem Zwang bleibt letztlich egoistisch. Dies ist die Regel. Doch Schopenhauer anerkennt: „Allein ebenso gewiss ist es, dass es Handlungen uneigennütziger Menschenliebe und ganz freiwilliger Gerechtigkeit gibt.“ „Es gibt in der Tat wahrhaft ehrliche Leute – wie es auch wirklich vierblättrigen Klee gibt.“
Schopenhauers Philosophie mündet deshalb nicht in einen Imperativ oder eine Morallehre; diese überlässt er mit guten Gründen der Moraltheologie. Er selbst setzt „der Ethik den Zweck, die in moralischer Hinsicht höchst verschiedene Handlungsweise der Menschen zu deuten, zu erklären und auf ihren letzten Grund zurückzuführen.“ Dieser letzte Grund ist für Schopenhauer der Charakter. In diesem überwiegen – als Potenzen – auf der einen Seite: der Egoismus mit Gier, Völlerei, Wollust, Eigennutz, Geiz, Habsucht, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit, Stolz, Hoffahrt usw. und Gehässigkeit mit Missgunst, Neid, Übelwollen, Bosheit, Schadenfreude, spähender Neugier, Verleumdung, Unverschämtheit, Unbändigkeit, Hass, Zorn, Verrat, Tücke, Rachsucht, Grausamkeit usw., auf der anderen Seite: Gerechtigkeit und Menschenliebe. (11)
In einer strengeren Systematik (12) nennt Schopenhauer anderswo drei Grundtriebfedern der menschlichen Handlungen: Egoismus, Bosheit und Mitleid. Mitleid umfasst Gerechtigkeitssinn und Menschenliebe. Schopenhauer nennt diese beiden in Anlehnung an die christliche Moral die Kardinaltugenden. Mitleid gilt Schopenhauer
als eine unleugbare Tatsache des Bewusstseins, ist diesem wesentlich eigen, beruht nicht auf Voraussetzungen, Begriffen, Religionen, Dogmen, Mythen, Erziehung und Bildung, sondern ist ursprünglich und unmittelbar, liegt in der menschlichen Natur selbst, hält eben deshalb unter allen Verhältnissen Stich und zeigt sich in allen Ländern und Zeiten; daher an dasselbe zuversichtlich appelliert wird.
Die so genannten Grundsätze der Ethik sind nach Schopenhauers Lehre nichts als ein Vorrat an abgeleiteten Sätzen, die jederzeit zur Anwendung bereitstehen, wenn sie den negativen Triebfedern entgegengesetzt werden sollen.
In anderen Einheiten des Studiengangs Denkmalpflege und Umnutzung, besonders in den beiden juristischen Modulen, ist vom Zusammenhang zwischen Denkmalpflegeethik und Denkmalpflegerecht ausführlicher die Rede. Hier zitiere ich ganz vorläufig Schopenhauers Brückenschlag von der Disziplin der Ethik zur Disziplin der Rechtslehre und zur Gesetzgebung:
Die Rechtslehre ist ein Teil der Moral, welcher die Handlungen feststellt, die man nicht ausüben darf, wenn man nicht andere verletzen, d. h. Unrecht begehen will. […] Gegen diese Handlungen errichtet der Staat das Bollwerk der Gesetze, als positives Recht. Seine Absicht ist, dass keiner Unrecht leide. Die Absicht der moralischen Rechtslehre hingegen, dass keiner Unrecht tue. (13)
(Abbildung 1) Die Ethik der Denkmalpflege hat es mit der Frage zu tun, ob die Beeinträchtigung, Zerstörung oder Vernichtung von Denkmälern ein Unrecht sei, durch das jemand leide. Dabei muss man sich vertraute exemplarische Fälle von Denkmalzerstörungen vor Augen zu führen und die mutmaßlichen Motive für die jeweilige Zerstörung mit Schopenhauers Katalog von Lastern zu vergleichen. (14) Ich selbst denke an die Zertrümmerung der Gerechtigkeitsfigur des Berner Gerechtigkeitsbrunnens und an die Zerstörung der Brücke von Mostar. Unter den möglichen Motiven für Denkmalzerstörungen finde ich bei diesen beiden Beispielen für einmal nicht den Eigennutz, begleitet von Geiz und Habsucht, sondern die Gehässigkeit mit ihren Begleitern Übelwollen, Bosheit, Schadenfreude, Hass, Zorn und Rachsucht.
(Abbildung 2) Meine beiden Beispiele sind mit einem Hintergedanken gewählt. Die Gerechtigkeitsfigur des Berner Gerechtigkeitsbrunnens ist zwar eine Skulptur und darf ohne weiteres als Kunstwerk gelten. Sie ist aber weder das Bildnis einer Gottheit, eines Heiligen, eines Heroen oder eines Helden aus der Geschichte, sie ist also nicht ein „stellvertretendes Bildnis“, (15) sie ist kein „Idol“, sondern die allegorische Darstellung einer Tugend, der Gerechtigkeit nämlich, die als Figur im öffentlichen Raum ein Bekenntnis des Gemeinwesens darstellt. Die Zertrümmerung dieser Figur gehört nicht zum Bildersturm im engeren Sinn. (16) Sie ist nicht ohne weiteres gleichzusetzen mit der Zerstörung von Reiterstatuen französischer Könige am Ende des 18. Jahrhunderts oder mit dem Niederreißen kolossaler Leninstatuen am Ende des letzten.
Das sorgfältig geplante Attentat geschah 1986. Der Anlass war die Enthüllung, dass die Berner Regierung nach der Abtrennung eines eigenständigen Kantons Jura vom bernischen Staatsgebiet, zu dem er 1814 geschlagen worden war, die probernische Partei im bernisch gebliebenen, aber französisch sprechenden Teil des Juras mit Staatsgeldern unterstützt hatte. So gesehen handelte es sich um die außergesetzliche Ahndung eines Unrechts durch die Zertrümmerung des Symbols, das in dieser Optik nicht ein Staatsziel, sondern bernische Selbstgerechtigkeit verkörperte. So etwa erklärte der Attentäter, Pascal Hêche, seine und seiner Mithelfer Tat. Zu diesem Zeitpunkt waren die für die Sache verantwortlichen Regierungsräte bereits zurückgetreten, um der öffentlichen Meinung im so genannten Finanzskandal Genugtuung zu verschaffen; zur Strafverfolgung wegen der Juragelder kam es jedoch nicht.
Unser Augenmerk gilt nur nebenher der Strafwürdigkeit der Tat und der Verurteilung des Täters; die Prozessakten zeigen indessen einerseits seine Motive, andererseits der Frage, welche Rechtsgüter verletzt wurden. Das Motiv lässt sich umschreiben als Hass auf den Kanton Bern; so wurde das Motiv auch vom Schweizerischen Bundesgericht genannt. Die Absicht war eine Be-Leidigung, man wollte ein Leid antun. Verurteilt wurde Hêche aber nicht für seine politische Überzeugung, sondern für die Zertrümmerung einer Statue von großem historischem und kulturellem Wert. Ankläger war der Eigentümer, die Einwohnergemeinde der Stadt Bern.
Der historische und kulturelle Wert lässt sich objektivieren; diese Werte dienen deshalb im positiven Recht, in Gesetzgebung und Urteilsfindung, als Kennzeichen von Denkmälern; dabei geht aber das Kriterium der affektiven Bindung, die nach vielen Theoretikern der Denkmalerhaltung und der Denkmalpflege zentral ist, teilweise oder gänzlich verloren.
Die emotionale Bindung der Einwohner der Stadt Bern, des Kantons Bern und vieler anderer Schweizer an den Gerechtigkeitsbrunnen versuche ich ohne Jahreszahlen verständlich zu machen, um die objektivierbaren historischen Werte von den Erinnerungswerten und anderen affektiven Werten zu scheiden. Ich halte noch fest, dass die zertrümmerte Figur aus Tausenden von Splittern zusammengesetzt und ins Historische Museum verbracht wurde. Auf der Brunnensäule steht seit 1988 eine Kopie.
Doch nun zum Corpus delicti. Öffentliche Trinkbrunnen waren bis vor kurzem eine Wohltat, auch mitten in Europa. Im Jahre des Attentats jedenfalls liefen die Menschen noch nicht mit Mineralwasserflaschen herum, um aus ihnen zu trinken, ohne im Gehen anzuhalten. Erst recht waren öffentliche Trinkbrunnen in geschlossenen Städten des Altertums, des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine Wohltat. Mit Stolz baute man Aquädukte, um Quellwasser in die Städte zu leiten, und mit Stolz schmückte man die Brunnen, wo Trinkwasser aus den Röhren sprudelte. Als man in Bern Mitte des 16. Jahrhunderts die Trinkwasserversorgung sanierte, krönte man das Werk entlang der Hauptgasse mit Brunnenbecken, Brunnensäulen und Brunnenfiguren, eigentlichen Denkmälern, in denen neben anderen Symbolen die Staatstugenden dargestellt wurden, so die Mäßigung (am fälschlich so genannten Anna-Seiler-Brunnen), die Tapferkeit (am Simsonbrunnen) und die Gerechtigkeit. (Abbildung 3) Die Figur der Gerechtigkeit hat zu Füßen die Büsten von Kaiser und Papst, Sultan und König von Frankreich, (17) den Herrschern, die sich damals bekämpften und über deren Machtgier die Gerechtigkeit als Tugend siegen wird.
Diese bemalte Steinfigur, genauer Figurengruppe, hat eine besondere Stellung im Stadtbild. Sie steht nicht weit von der Kreuzgasse, die Münster und Rathaus verbindet und von der Kreuzung, an der einst öffentlich Gericht gehalten wurde; was die Gerechtigkeit in der Perspektive der Hauptgasse, die hier Gerechtigkeitsgasse heißt, auszeichnet, ist der offene Blick auf den gegenüberliegenden, nur wenig überbauten Aarehang und damit ein einzigartiger Hintergrund. Rechts und links von der Gasse aber reihen sich ununterbrochen die Sandsteinfassaden, deren Bau staatliche Förderung genoss und für die Bern schon im 18. Jahrhundert berühmt war. Dass aber diese Stadterhaltung nicht nur eine Folge der Schonung und Pflege, sondern zunächst ein Zeichen zeitweiliger wirtschaftlichen Stagnation, ja Abstiegs der unteren Altstadt ist, sei hier mit dem Hinweis auf meines Kollegen Martin Fröhlich Stadtbetrachtungen angemerkt. Ein Indiz für die affektive Bindung der Einwohner ist die Beliebtheit der Gerechtigkeitsfigur als Postkartensujet.
Das Leid, das den Einwohnern von Stadt und Kanton Bern, ja der ganzen Schweiz, deren Hauptstadt getroffen war, angetan wurde, als die Statue der Gerechtigkeit zu Trümmern ging, äußerte sich spontan in der gleichen Tages veröffentlichten Stellungnahme der Stadtregierung sowie in unzähligen Presseartikeln und Leserbriefen über mehrere Wochen hinweg. Wie immer bei affektiven Bindungen wurde der Verlust vor allem als Kränkung wahrgenommen. Die Attentäter hatten ihr Ziel erreicht.
Ich hätte als ein jüngeres Beispiel die Zerstörung der Felsskulpturen von Bâmiyân im Jahre 2001 vorführen können. (18) Doch damit würden wir die Frage des Weltkulturgutes berühren, die in andere Unterrichtsmodule gehört. (Abbildung 4) Lieber ist mir deshalb, auch weil sie ein Bauwerk gewesen ist, die Brücke von Mostar in Südbosnien. Sie spannte sich seit 1557 in einem einzigen Steinbogen über den Fluss. Im November 1993 wurde sie durch kroatische Granaten zerstört. Die symbolische Dimension der Zerstörung erhellt aus dem Bekenntnis vieler Einwohner der muselmanischen Stadt, sie wären lieber selbst das Opfer gewesen, und aus dem in den Jahren 1995–2004 erfolgten formgetreuen Wiederaufbau. Ende Januar 2008 las man die Nachricht, die Brücke von Mostar werde nur Weltkulturerbe bleiben, wenn das angrenzende Ruza Hotel die alte Höhe respektiere und die obersten Stockwerke abbreche. (19)
Aus der Frage nach dem Leid, das Hass einem Kollektiv durch Zerstörung von symbolischen Werten antut, schält sich gleichsam ein auf dem ethischen Grundsatz „Tue niemandem ein Leid an“ fußender Denkmalbegriff heraus. Symbolcharakter, verbreitete Wertschätzung, emotionale Bindung mögen als Eckpunkte einer Definition dienen. Kollektive Vergangenheit und Zukunft, die den Symbolcharakter garantieren, wird sich in einem dritten Beispiel als Ziel einer Beleidigung zeigen. Es stammt aus der Zeit der Industrialisierung und der Umwertung aller Werte und betrifft einen Ort der Erinnerung, der als Naturdenkmal wie als Kulturdenkmal gleichermaßen Wertschätzung genießt und jederzeit politisch instrumentiert werden kann.
(Abbildung 5) Ich meine die Rütliwiese in der Gemeinde Seelisberg, Kanton Uri. (20) Lassen Sie mich etwas ausholen.
Im Herbst des Jahres 1836 nahm der Raddampfer „Stadt Luzern“ seine Fahrten auf. Alsbald wurden die Postkurse auf der zwischen 1820 und 1830 gebauten Fahrstraße über den St. Gotthard an die Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee und auf dem Langensee angeschlossen. (Abbildung 6) Schon 1842 konnte die Fahrzeit Luzern–Mailand auf 311/2 Stunden gedrückt werden. Damit wurde die St.-Gotthard-Route zur kürzesten Verbindung über die Zentralalpen, schneller als die Bündner Pässe und der Simplonpass. Bis zur Eröffnung der Gotthardbahn im Jahre 1882 waren es also Raddampfer, welche den Weg abkürzten.
Die Dampfschifffahrt erschloss aber auch bisher abgelegene Orte für den „Tourismus“. Zu den begünstigten Orten gehörte auch Seelisberg, das 1854 eine Dampfschiffstation erhielt. 1858 wurde auf dem Rütli, das schon längst als Wiege der Eidgenossenschaft galt, ein Hotelbau begonnen. Eigennutz hatte alle Wenn und Aber verdrängt. Die Entrüstung der auf dem Dampfschiff am Bauplatz vorbeifahrenden Mitglieder der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft führte zu Verhandlungen mit dem Eigentümer, zu einer nationalen Geldsammlung für die Erwerbung, an der sich die Schweizer Jugend hervortat, zum Kauf und zur anschließenden Übergabe als unveräußerliches Nationalheiligtum an die Bundesbehörden. (21)
(Abbildung 7) Im Schicksal der Rütliwiese sind Naturdenkmal und Kulturdenkmal miteinander verquickt; für den Komplex „Industrialisierung und Naturschutz“ ist der Januskopf des Tourismus bezeichnend, der dem Genuss der Natur dient, aber diese zu zerstören droht. Das hat sich nicht geändert, auch wenn Dampfschiff und Dampfbahn durch andere Personentransportmittel ersetzt worden sind. Übrigens wurde das Naturdenkmal auch durch Gartenkunst zum Kulturdenkmal.
(Abbildung 8) Noch etwas anderes gibt diese Geschichte zu bedenken. Die Initiative zur Rettung der Rütliwiese vor der Beeinträchtigung durch einen bereits begonnenen Hotelbau ging zwar von teilweise hochgestellten Persönlichkeiten aus, aber nicht von den kantonalen oder den eidgenössischen Behörden, sondern von einer privaten Gesellschaft, der es gelang, die Sache in die Hand zu nehmen, zu einer Volksbewegung zu machen und zu einem guten Ende zu führen. Damit wären wir zu unserem Thema „Ethik“ zurückgekehrt.
Kant und Schopenhauer haben ihre Ethik für das Individuum entworfen. In Kants Ethik gilt die Maxime des Handelns als Maßstab. Ob durch Sanktionen wie gesellschaftliche Ächtung oder staatliche Strafverfolgung oder durch Einsicht gelenkt, bleibt letztlich gleichgültig. Anders bei Schopenhauer. Indem er die Motive des rechten und des unrechten Handelns zum Maßstab nimmt, erscheinen Sanktionen als ein die Verantwortung einschränkender Zwang. Damit lässt er uns für das kollektive Verhalten ratlos.
Kants Lehre ist der Schopenhauers darin überlegen, dass sie das Objekt der Verantwortung als Gemeinwohl versteht; in Kants kategorischem Imperativ ist das Gemeinwohl universal gedacht, es ist nicht bloß das Wohl des Individuums, der Gruppe, der Religionsgemeinschaft oder der Nation, ja nicht einmal ausschließlich der Menschheit. Daher die Forderung so zu handeln, dass die Richtlinie oder Maxime des Handelns zum „allgemeinen Naturgesetz“ werden könnte.
Wie sollen wir dieses Postulat ethischen Handelns auf das Gebiet der Denkmäler anwenden? Wir fassen zunächst das Gebiet der Denkmäler für unsere Überlegungen nicht zu eng, sondern stellen es uns mit den verschiedensten menschlichen Hervorbringungen besetzt vor, die für ein Individuum, eine Gruppe, eine Religionsgemeinschaft, eine Nation oder die Menschheit zum Erinnerungszeichen geworden ist oder werden könnte. Wir treffen daraus eine Auswahl des Bebauten und des Gebauten: nehmen Sie den Olivenhain, den Weinberg, die Haselhecke, die Feldsteinmauer, den Feldweg, das jährlich frisch bestellte Feld und seinen charakteristischen, viele Jahre überdauernden Umriss, den Holzweg, den jährlich durch Holzfällen und Baumpflanzungen veränderten Wald mit seiner charakteristischen Flora, die Bachverbauung, den einsamen Hof, das Dorf, die Stadt, die Autobahn und ihren Saum von Lagerhallen, ja, warum nicht, den See mit seinen Bojen und Booten, seinen Schiffen und Schiffswerften.
Aus dieser Auswahl treffen wir erneut eine Auswahl des Gebauten, aber doch so, dass alles, was zum Tiefbau und zum Hochbau gezählt zu werden pflegt, ohne weitere Auswahlkriterien in unserem Sieb bleibt. Jetzt errichten wir darum einen gewaltigen Zaun mit dem charakteristischen Umriss der schweizerischen Landesgrenzen – und wir haben das vor uns, was Martin Fröhlich „Die gebaute Schweiz“ nennt und was wir zum Gegenstand unseres Nachdenkens machen wollen.
Handlungsbedarf entsteht da, wo ein Bedürfnis nicht aufgeschoben werden kann. Welches Bedürfnis, so frage ich, fordert denkmalpflegerisches Handeln? Ich sage nicht „fordert das Einschreiten der Denkmalpflege“, sondern spreche verallgemeinernd vom „denkmalpflegerischen Handeln“. Es geht nämlich auf dem Problemfeld „Die gebaute Schweiz“ nicht einfach darum, dass eine bestimmte Verwaltungsaufgabe, die „Denkmalpflege“, nach dem Buchstaben des Gesetzes erfüllt wird, sondern dass jede Bürgerin, dass jeder Bürger, dass jede Einwohnerin, dass jeder Einwohner dieses Landes die gebaute Schweiz nach ethischen Grundsätzen behandelt und pflegt. Es ist grundsätzlich dasselbe Bedürfnis, das die Pflege der Baudenkmäler einerseits zur Verwaltungsaufgabe macht und andererseits die Tätigkeit der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz und anderer privater Gesellschaften bestimmt. (22)
Welches ist dieses Bedürfnis? Warum liegt Handlungsbedarf vor? Nach verbreiteter Auffassung, die ich teile, ist es immer wieder der drohende oder der eingetretene Verlust vertrauter Orientierungszeichen in Zeit und Raum, der von Krankheit befallenen uralten Ulme so gut wie der im Artilleriefeuer ausgebrannten Kathedrale, ist es der Verlust von Natur- oder Kulturdenkmälern, der Schutzmaßnahmen herausfordert, damit das Unglück abgewendet oder gegen ähnliche Unglücksfälle vorgesorgt werden kann. Das Verschwinden ganzer Baumgärten, ganzer Wälder, ganzer Wohnviertel, ganzer Industrieanlagen, nicht schön, aber vielen hundert Menschen vertraut, wird heute von diesen als Verlust empfunden. Im Krebsgang der Geschichte betrachtet: Gestern waren es die Zerstörungen durch zu schnell und zu gewaltsam durchgeführte Stadtplanung und Güterzusammenlegung oder die Zersiedelung bäuerlicher Kulturlandschaft infolge zu langsam und zu nachlässig durchgeführter Landesplanung, vorgestern der Bauboom der Gründerjahre und der Eisenbahnbau, vorvorgestern die Denkmalzerstörung durch Krieg und Revolution. Nicht die langsame, stetige Veränderung der Umwelt, sondern die abrupte oder bloß schleichende, aber das Gefühl der Ohnmacht auslösende Veränderung der Umwelt, nicht der Verlust, sondern die Häufung von Verlusten, nicht die Trauer um ein verschwundenes persönliches Erinnerungszeichen, sondern die Trauer um kollektive Erinnerungszeichen, nicht nur die Qualität des Verlustes, sondern auch die Quantität, erheischen auf dem Problemfeld „Die gebaute Schweiz“ gewissenhaftes Handeln.
Gewissenhaftes, gerechtes, verantwortungsvolles, vorsichtiges, behutsames Handeln wird geleitet vom Abwägen von Gütern, ethisches Handeln vom Abwägen kollektiver Güter, die oft immaterielle Werte darstellen. Im Bauwesen ist es besonders offensichtlich, dass unsere Vernunft dies nicht nur aus Achtung vor den Voreltern und aus Verantwortung für die Mitmenschen, sondern auch, genau wie Naturschutz oder Sprachpflege, im Blick auf die Nachgeborenen zu tun gebietet.
II. Vom haushälterischen Umgang mit allerlei Dingen
(Abbildung 9) Zwischen Bordeaux und Toulouse, näher bei diesem, liegt die kleine Stadt Moissac mit dem ehemaligen großen Benediktinerkloster. Berühmt sind der Kreuzgang mit der Jahreszahl 1100 und die romanische Portalvorhalle auf der Südseite der Kirche, mit ihren Reliefs: am Portal selbst das Jüngste Gericht nach der apokalyptischen Offenbarung des Johannes, die zwei lebensgroßen Propheten Jesaja und Jeremia sowie die ebenfalls lebensgroßen Apostelfürsten Petrus und Paulus. Dazu kommen auf den inneren Seitenwänden der Vorhalle Szenen aus der Jugendgeschichte von Jesus Christus, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus (Abbildung 10) und, passend zur Parabel und ihrer Sentenz, die Allegorien der Laster des reichen Mannes, die Allegorie der Habsucht und die Allegorie der Verschwendung.
(Abbildung 11) Die Verschwendung, der Luxus oder, weil Allegorien weiblich sind, die „Luxuria“, die dem reichen Mann im Gericht der Endzeit die Hölle garantiert, ist besonders gräulich dargestellt. Sie erscheint als nackte, entfleischte Frau; zwei Schlangen hängen sich an ihre Brüste, eine Kröte verzehrt ihr Geschlecht. Von links tritt der Teufel herzu. Das ist nicht die Ausgeburt einer auf Keuschheit verpflichteten Mönchsphantasie, sondern eine Ermahnung an alle Kirchgänger, sich vor Verschwendung zu hüten, und eine Drohung, der Verschwender werde bestraft, und sei es auch erst im Jenseits.
(Abbildung 12) Warum galt Verschwendung als Laster? Im Gleichnis aus dem Lukasevangelium der Bibel (16, 19–31) ist nicht der Luxus an sich ein Laster, sondern die Unbarmherzigkeit, die es dem Reichen verbietet, dem armen und kranken Lazarus die Brosamen von seinem Tisch zu gönnen.
Zum unmittelbaren Laster aber wird Verschwendung in jeder Gesellschaft, in der die Güter allzu ungleich verteilt sind oder die am Rande des Mangels lebt. Können wir uns heute vorstellen, selbst wenn wir es wissen, dass ein Leben am Rande des Mangels in Raum und Zeit die Regel ist? Wer von uns kennt Menschen, die eine Hungersnot erlitten, die eine Tod bringende Epidemie wie die Pest und die Cholera überlebt haben? Und doch wurde Europa noch im 19. Jahrhundert von Choleraepidemien heimgesucht. Die wiederkehrenden Missernten waren damals auch in Europa katastrophal.
Als in Moissac, zu Beginn des 12. Jahrhunderts, ein Bildhauer den Auftrag erhielt, die Luxuria darzustellen, hatte Europa gerade eine lange Zeit der Knappheit hinter sich. Für über zweihundert Jahre erwärmte sich nun das Klima, die Bauern produzierten regelmäßiger, riesige Kathedralen wurden errichtet und kostbar ausgestattet, zahllose Städte gegründet, steinerne Burgen gebaut, bis um 1310 die Kleine Eiszeit und um 1350 der erste Pestzug einsetzten und Europa zur Mangelwirtschaft zurückkehrte. Die wirksame staatliche Vorratshaltung in Kornhäusern und die hilflosen Vorhaltungen in den Sittenmandate gegen die Verschwendung verstehen sich als zwei ungleichartige und ungleich wirksame Mittel des Ancien Régime, die ärgste Not zu lindern und in der Not die Armen nicht auch noch mit Luxus zu provozieren.
Wozu diese christlich gefärbte Einleitung? Ich möchte im Folgenden zeigen, dass Verschwendung auch in philosophischer Sicht (23) und in ethischer Perspektive ein Fehlverhalten ist.
Dabei folge ich zwar streckenweise den bekannten ökologischen Argumentationen, aber es geht mir nicht um die Verschwendung von Gütern der Natur, sondern um die Verschwendung von Gütern der Kultur, nicht um Rohstoffe und Energieträger, sondern um Bauwerke und Kunstwerke, nicht um nachhaltige Forstwirtschaft (dort sprach man zuerst von Nachhaltigkeit), ja überhaupt nicht um Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit, auch nicht in der Langzeitperspektive, sondern um das altväterische Haushalten mit Gütern.
Wo liegt der Witz von der Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus? Nicht darin, dass sich der Reiche in Samt und Seide kleidet, nicht darin, dass er täglich Feste feiert, sondern darin, dass er dem armen Lazarus nicht einmal den Überfluss, die Brosamen, gönnt. Und es ist eine besondere List des Geschichtenerzählers oder des nacherzählenden Evangelisten Lukas, dass der Reiche nur als anonymer Typus erscheint, der arme Mann aber einen Namen erhält, Lazarus. Es geht auch nicht darum, dass alle gleich viel erhalten, sondern darum, dass die Verschwendung von Gütern, mit denen Not gelindert werden könnte, ein Unrecht an den Not Leidenden darstellt. Das gilt im Kleinen, das gilt im Großen, das gilt in weltgeschichtlicher Perspektive. Ich meine das so.
In weltgeschichtlicher Perspektive erhält jedes Individuum einen Kredit an Zeit, Kraft und Talenten. Es ist kein Eigentum, es ist ein Kredit. So gesehen ist es immer „das Geld des Anderen“, womit wir arbeiten. Die haushälterische Mitte zwischen Habsucht und Verschwendung entspricht dem Umgang mit fremdem Gut, entspricht der Lage des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, man mag diesen „die Gesellschaft“,„die Menschheit“, „das Göttliche“ oder „den Schöpfer“ nennen. So jedenfalls ist es im Gleichnis von den Talenten des Matthäusevangeliums (25, 14–30) gemeint. Von daher ist übrigens, gleichnishaft, aus der antiken Münzeinheit der Talente – einige tausend Euro – ein Begriff für Gaben des Geistes und des Herzens geworden.
Freilich, Verschwendung als Verschwendung mühelos zu erkennen, setzt übersichtliche Verhältnisse voraus. Ökologisch betrachtet, ist der Transport von rasch verderblichen Lebensmitteln mit Flugzeugen um den halben Erdball eine Verschwendung; aber wie erkenne ich das beim Einkauf, wenn der Apfel aus Südafrika weniger Geld kostet als der Apfel aus Bolligen oder Nussbaumen?
(Abbildung 13) Von den Naturgütern zu den Kulturgütern! Ich kehre noch einmal in die Entstehungszeit der Skulpturen in der Portalvorhalle der Klosterkirche von Moissac und besonders zur Allegorie der Luxuria zurück, in die Jahre um 1125.
Zu jener Zeit wurde Verschwendung sogar im Kirchenbau gerügt, wie sie gerade damals die Benediktiberabtei Cluny maßlos übte. Der Abt Bernhard des Zisterzienserkloster Clairvaux schrieb damals an den Abt Wilhelm des Benediktinerklosters Saint-Thierry einen Brief, der in vielen Abschriften veröffentlich wurde. Darin führt Bernhard aus: (24)
Ich übergehe der Kirchen ungeheure Höhe, maßlose Länge, überflüssige Breite, verschwenderische Steinmetzarbeit und die Neugier reizenden Malereien, die den Blick der Betenden auf sich lenken und die Andacht verhindern. […] Was tut hier überhaupt die Habgier, die der Dienst der Götzenbilder doch ist? […] Es strahlt die Kirche in ihren Mauern, und in ihren Kindern leidet sie Mangel. Ihre Steine kleidet sie in Gold, und ihre Kinder lässt sie nackt. Mit den Gaben der Bedürftigen wird den Augen der Reichen gedient.
(Abbildung 14) Das Ärgernis liegt für Bernhard von Clairvaux nicht bloß darin, dass die Kirche als Institution ihre Mittel falsch investiert, in Luxus nämlich statt in die Armenpflege, sondern in der unverfrorenen Zurschaustellung der Verschwendung, in der Prahlerei mit Luxus. Bernhard führt das nicht aus, aber zeigt es in der Gegenüberstellung der in Gold gekleideten Mauern der Kirchenbauten und der in Lumpen gehenden Bedürftigen: Der Gegensatz verletzt die Würde der Armen, ihre Menschenwürde.
Die Zisterzienser, denen Bernhard von Clairvaux angehörte, vermochten in den ersten Jahrzehnten in ihrem Orden niedrige, schmucklose Kirchen durchzusetzen; als Beispiel diene die ehemalige Abteikirche von Bonmont, Gemeinde Chéserex, Kanton Waadt, begonnen um 1140.
Wir haben uns dem Reich der Artefakte genährt. Der Ausdruck das Artefakt ist den Archäologen geläufig, denn er bezeichnet in der Ur- und Frühgeschichte, was von Menschenhand geformt ist oder wenigstens Bearbeitungsspuren trägt, eine Silexklinge zum Beispiel, ein „Kunsterzeugnis“ im Gegensatz zu einem Naturprodukt, wie es der Brockhaus von 1908 will; Artefakt hat heute auch die Nebenbedeutung von „Kunstwerk“ (Duden, Rechtschreibung, 2006). In der vom englischen Sprachgebrauch geprägten anthropologischen Bedeutung umfasst das Reich der Artefakte eine riesige Fülle von Dingen, die Menschenhand und -verstand je geschaffen haben.
Selbst im allerweitesten Sprachgebrauch ist es üblich, als Artefakt nur ein Ding zu bezeichnen, das für den mehrfachen oder einfachen, aber länger dauernden Gebrauch geschaffen ist, nicht aber was zum Verbrauch und zum Verzehr dient. Der beabsichtigte Zeithorizont und das tatsächliche Alter gehören also zur Umschreibung von Artefakt. Ich nenne einige Beispiele von eindeutigen Fällen und von Grenzfällen. Artefakte des alten Ägypten sind die Pyramiden, die Sphinxe, die Mumiensarkophage, das Haupt der Nofretete, die steinernen Würfelhocker, die Skarabäen. Freilich wird man die Pyramiden in der Regel nicht als Artefakte bezeichnen, sondern sogleich einer Unterkategorie zuteilen, der Kategorie der Denkmäler oder der Unterkategorie der Baudenkmäler nämlich, oder in die Funktionskategorie der Grabbauten. Und Grabbauten und Grabbeigaben sind der Absicht nach für die Ewigkeit geschaffen.
Die meisten Artefakte werden für den irdischen Gebrauch geschaffen. Sie tun eine Zeit lang ihren Dienst und verschwinden dann wieder. Mit Werkzeugen wie Sichel und Hammer, Videomonitor und Computer, Bleistift und Radiergummi, Tintenfass und Tinte geht es so. Aber schon sind wir an der Grenze zwischen Gebrauch und Verbrauch angelangt. Ein Bleistift mag noch als Artefakt hingehen, die Tinte ist es nicht als zu verbrauchende Flüssigkeit, sondern als Teil des Artefaktes Privatbrief. Der Absicht nach in der Regel für den einmaligen Gebrauch – sprich Lesen – angefertigt, also ein Artefakt, gehört ein länger aufbewahrter Privatbrief in die Unterkategorie der Dokumente oder aus der Sicht des Historikers zu den Schriftquellen. Eine Pastete ist für den Verzehr bestimmt; gleichwohl würde ich sie unter die Artefakte einreihen, die sich den Augen als Kunstwerke darbieten. Kein Wunder, dass im 17. Jahrhundert solche Pasteten im Stillleben verewigt wurden, und zwar als Symbole der Vergänglichkeit, und dass man die Festtafel oder das Feuerwerk von Fürstenhochzeiten im Kupferstich festhalten wollte.
In die Liste der Gebrauchsgegenstände habe ich mit Absicht auch seriell und maschinell hergestellte Artefakte wie den Videomonitor aufgenommen, um darzulegen, dass Handarbeit kein primäres Kriterium darstellt, wenn wir den Begriff Artefakt definieren.
Gleichwohl ist die Unterscheidung zwischen Maschinenarbeit und Handarbeit wesentlich, ebenso, nicht deckungsgleich, aber auf ähnliche Weise, die Unterscheidung zwischen Serienprodukt und Einzelanfertigung. Dass es auch hier einen breiten Grenzstreifen gibt, zeigen die Münzenprägung, die Glasbläserei, die Keramik, die Weberei, die Möbelherstellung usf.
(Abbildung 15) Beim Artefakt, das der Maschinenarbeit entstammt, überwiegt bei Verschwendung der Verlust an Rohstoffen und Energie. Diese Fälle von Verschwendung gehören ins Ressort der Ökologie. Beim Artefakt, das der Handarbeit entstammt, überwiegt bei Verschwendung der Verlust an Arbeit. Ich sage nicht Arbeitszeit und sage nicht Arbeitsleistung, sondern Arbeit, um zu unterstreichen, dass es sich um inkommensurable Größen handelt, Arbeitslust, Arbeitsleid, Arbeitsökonomie. Es ist kein Zufall, dass mit dem Aufkommen des industriellen Zeitalters die Handarbeit neu bewertet wurde. Ich nenne dafür zwei berühmte Zeugen: den Engländer John Ruskin (1819–1900) mit seinem Buch The Seven Lamps of Architecture, veröffentlicht 1849, und den Franzosen Henri Focillon (1881–1943) mit seinem Essai L’éloge de la main von 1934. Die Sieben Leuchter der Baukunst von Ruskin sind das Buch eines Eiferers, aber sie sind verständlich als Reaktion auf das Überhandnehmen der Maschinenarbeit. Bezeichnend ist der folgende Passus: (25)
Ich glaube, die einzige entscheidende Frage bei allem Ornament ist einfach diese: War es mit Vergnügen und Genuss gemacht? war der Bildner glücklich, als er daran meißelte? Es mag die denkbar schwerste Arbeit sein, um so härter, weil so viel Genuss dabei war; aber sie muss auch glücklich und glühend und gläubig gewesen sein: sonst wird sie nicht leben.[…] Unlängst ist in der Nähe von Rouen eine gotische Kirche gebaut worden, gemein genug in der Tat, was ihre Anlage betrifft, aber übertrieben reich im Detail; viele Einzelheiten sind mit Geschmack erdacht und alle offenbar von einem Mann, der alte Arbeit genau studiert hat. Aber alles ist so tot wie Blätter im Dezember; nicht ein einziger feinfühliger Strich, nicht ein herzenswarmer Schlag auf der ganzen Fassade. Die Männer, die sie ausführten, hassten sie und waren dankbar, wenn sie damit fertig waren.
Es handelt sich um die Wallfahrtskirche Notre-Dame de Bon-Secours bei Rouen, im Vorort Blosseville, erbaut 1840–1844 von Jacques-Eugène Barthélemy, ein frühes und, wie Ruskin richtig gesehen hat, sehr sorgfältig geplantes, in der Ausführung aber mechanischer Perfektion und Zeit sparender Arbeitsteilung gehorchendes Werk.
(Abbildung 16) Beim Kunsthistoriker Henri Focillon, rund hundert Jahre später, finden wir mehr Sinnlichkeit als Eifer, mehr kulturgeschichtliche Einsicht als kulturpessimistischen Abscheu. Wohlgefällig schweift sein Blick über gotische Architektur und gotisches Handwerk und schließlich weit zurück bis in die Steinzeit. So heißt es in seinem Lob der Hand zu Hand und Werkzeug: (26)
Der Höhlenbewohner, der den Stein durch sorgfältiges Abhauen von Splittern schneidet und Knochennadeln herstellt, weckt in mir ein viel größeres Erstaunen als der gelehrte Maschinenkonstrukteur. Er wird nicht mehr von unbekannten Kräften getrieben, sondern treibt aus eigener Kraft. […] Das Werkzeug als solches ist nicht weniger bemerkenswert als der Gebrauch, zu dem man es bestimmt; es ist in sich selbst Wert und Ergebnis. Es ist da, losgelöst von der übrigen Welt, ein einmaliger Akt. Selbst wenn der Rand der Muschel eine so scharfe Schneide besitzt wie das Steinmesser, so hat man letzteres doch nicht zufällig an irgendeinem Strand aufgelesen, man kann es das Werk eines neuen Gottes nennen, das Werk und die Verlängerung seiner Hände. Zwischen Hand und Werkzeug beginnt eine Freundschaft, die nicht mehr enden wird. Die eine teilt dem andern ihre lebendige Wärme mit und bearbeitet es unaufhörlich. […] Ich weiß nicht, ob zwischen der handwerklichen und der mechanischen Ordnung ein Bruch besteht, ich bin dessen nicht sehr sicher, aber das Werkzeug als Fortsetzung der Hand gehört zum Menschen […].
Henri Focillon deutet den Topos von der Urhütte und die Abbildung aus Marc-Antoine Laugiers Essai sur l’achitecture (Abbildung 17) auf seine Weise, konzentriert sich jedoch auf das Werk der Hand: (27)
Ihr genügt nicht zu nehmen, was da ist, sie muss an dem arbeiten, was nicht ist, und zum Reich der Natur ein neues Reich fügen. Lange Zeit genügte es ihr, ungehobelte Baumstämme in der ganzen Pracht ihrer Rinde aufzustellen, damit sie die Dächer von Häusern und Tempeln trügen; lange Zeit häufte oder legte sie unbehauene Steine aufeinander, um der Toten zu gedenken oder die Götter zu ehren. Solange sie Pflanzensäfte benützte, um die Monotonie des Gegenstandes zu beleben, achtete sie noch der Gaben der Erde. Aber von dem Tag an, da sie dem Baum sein knorriges Gewand nahm, um sein Fleisch sichtbar werden zu lassen, und die Oberfläche zu bearbeiten, bis sie glatt und vollkommen wurde, von diesem Tag an erfand sie eine neue Haut, die für Auge und Berührung angenehm ist; und die Maserung, die zutiefst verborgen bleiben sollte, enthüllte im Tageslicht geheimnisvolle Linienspiele. Die amorphen, im Chaos der Berge vergrabenen Massen des Marmors schienen, einmal zu Blöcken, Platten und Menschenbildern gehauen, ihr Wesen und ihre Substanz zu ändern, gerade als ob die Form, die ihnen gegeben wurde, sie bis in die tiefste Tiefe ihres blinden Seins und bis in ihre Elementarteile hinein verwandelte.
Gewiss spricht Focillon immer wieder von Kunstwerken, gewiss erlaubt ihm der französische Sprachgebrauch einen leichten Übergang von Handwerk zu Kunst, entscheidend ist für unseren Gedankengang aber, dass für ihn die Artefakte ein Kontinuum darstellen, von Kunst zu Handwerk zu Technik, ohne dass es unten und oben, Zentrum und Peripherie gäbe, gesagt wird nur, das von Hand Geschaffene sei etwas Besonderes, und zwar durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Werkzeug und mit dem Werkstoff.
Einen dritten Lobredner der Hand möchte ich noch zu Wort kommen lassen, einen, der nicht von der Freude am Schaffen, sondern von der Freude am Pflegen spricht, Georg Mörsch. Ausgehend davon, dass die öffentliche Denkmalpflege immer nur einen Teil der Artefakte (ein Terminus, den auch Mörsch braucht) schützt und pflegt und dass auch ihre Pflege nur einzelne Aspekt umfasst und zeitlich intermittierend stattfindet, setzt er das Ziel „einer Konditionierung zu integralem Schutzverhalten unserer Gesellschaft“. Dieses Ziel wurde bisher nicht erreicht, die Botschaft, sagt Mörsch, war zu intellektuell: (28)
Es muss deshalb überlegt werden, ob es nicht Formen des Umgangs mit dem Denkmal gibt, die solches Schutzverhalten besser erzielen und die
gleichzeitig die Identifizierung, das Selbst-Bewusstsein des Schützenden durch außerkognitive Eindrücke verstärken. Das Ziel wäre also, Identität zu finden durch das, was ich am Denkmal tue, statt oder neben dem, was ich von ihm weiß, Identität nicht so sehr im Besitz zu suchen, als vielmehr im Umgang mit ihm zu erleben. Als Analogie mag Erkenntnis- und Schutzverhalten aus vielen anderen Lebensbereichen gelten. So banal es klingt: Das Tier, über das mich die Zoologie alles gelehrt hat, gewinne ich erst lieb, wenn ich es füttern darf.
Nun ist das Wort Denkmal zum zweiten Mal gefallen, und ich komme nicht darum herum, innerhalb der ungezählten und unzähligen Objekte, deren Verschwendung ich für unziemlicher halte als ihre Verwendung und Entfremdung, Kategorien zu nennen, die gegenwärtig der besonderen Zuneigung, Schonung und Pflege bedürfen. Um mich nicht durch das Gestrüpp moderner Denkmaldefinitionen, Denkmalwerte und Denkmalansprüche schlagen zu müssen, nehme ich zwei altbewährte Begriffe.
In seinem Wörterbuch der Kunst beschreibt Filippo Baldinucci 1681, was richtige, was falsche Behandlung von Gemälden ist. Statt restaurare sagte man damals in Italien gerne rifiorire, „aufblühen lassen“. Ich übersetze aus dem Italienischen: (29)
Rifiorire heißt gleichsam aufblühen lassen; das ist ein sehr volkstümlicher Ausdruck, womit die kleinen Leute jene unerträgliche Dummheit auszudrücken pflegen, ein altes Gemälde, das sich im Laufe der Zeit geschwärzt hat, gelegentlich mit neuer Farbe zu übermalen, und dazu noch durch einen unerfahren Meister. Dadurch benimmt man dem Gemälde aber nicht nur seine Schönheit, sondern auch seinen Alterswert. Man sollte unter Restaurieren oder Sanieren oder Instandsetzen etwas anderes verstehen, nämlich das Ausflicken einer Fehlstelle eines Gemäldes, eines Ausbruchs oder eines anderen Schadens, und zwar durch einen guten Meister, denn solches gelingt einer Meisterhand mit Leichtigkeit. Es scheint dann, als ob man von dem Gemälde einen Fehler weggenommen habe, der ihn, so klein er war, in Ungnade und Misskredit brachte. Viele in der Kunst Erfahrene haben jedoch die Meinung geäußert, dass die allerbesten Gemälde überhaupt nicht retuschiert werden dürften, von wem auch immer. Das Retuschieren sei nämlich so schwierig, dass man mehr oder weniger, über kurz oder lang, auch die kleinste Restaurierung erkenne. Ein Gemälde, das nicht ganz original ist, wird immer Misstrauen begegnen.
Baldinucci führt dann im Einzelnen aus, welche Schäden an der Oberfläche des Gemäldes durch falsche Maßnahmen entstehen. Ich habe den Passus aber nicht als ein frühes Zeugnis für den Ruf nach bloß konservierenden Maßnahmen zitiert, sondern wegen seiner Begründung dafür: Weitergehende Maßnahmen zerstören die Schönheit und den Alterswert, „l’apprezzabile dell’antichità“.
Zu den Bauwerken und sogar zu den Ruinen, die keinen Gebrauchswert zu haben scheinen, führt jener Geburtsschein der Denkmalpflege, den man gewöhnlich „Denkschrift über Denkmalpflege“ nennt: ein Memorandum, an dem anscheinend verschiedene Künstler und Gelehrte arbeiteten, und das, soviel wir wissen, der Maler Raffael um 1520 dem Papst Leo X. aus dem Hause Medici vorlegen wollte. Der Tod des Künstlers scheint das verhindert zu haben. Hervorgegangen ist das Memorandum aus Raffaels Auftrag, die Ruinen des alten Rom aufzunehmen (Abbildung 18). Diese Denkmäler erscheinen dem Verfasser als Zeugen der Pax Romana, des Vorbildes für einen ewigen Frieden unter den Christen, den zu erreichen des Heiligen Vaters Aufgabe sei. (30) Ich zitiere aus einem der Entwürfe zu der Denkschrift:
Meine Denkmälerkenntnis verschafft mir einerseits wahre Genugtuung, weil ich eine hervorragende Sache kennen gelernt habe; andererseits ist sie auch Ursache tiefen Schmerzes, wenn ich gleichsam den Leichnam der edlen Vaterstadt, die einst die Welt regierte, traurig zerfleischt sehe. Gleich wie für jeden Einzelnen die Pietät den Eltern und dem Vaterland gegenüber Pflicht ist, ebenso fühle ich mich verpflichtet, alle meine geringen Kräfte daranzusetzen, dass soweit als möglich ein Stück von dem Bild lebendig bleibe, oder vielmehr der Schatten dessen, was in Wahrheit das Vaterland aller Christen ist, welches einst so vornehm und so mächtig war, dass die Menschen zu glauben begannen, dieses Reich stehe über dem Schicksal.
Pietät erscheint hier als der tiefste Beweggrund für den Schutz und die Pflege der Denkmäler. Es gehört zu meinen im Verlaufe vieler Jahre gefestigten Überzeugungen, dass Pietät der Name der Tugend ist, welche Schutz, Erhaltung und Pflege der Bau- und Kunstdenkmäler motiviert.
Sparsamkeit statt Verschwendung, Achtung vor dem Wert menschlicher Arbeit jenseits der Wirtschaftlichkeit, Sorgfaltspflicht gegenüber dem Alterswert eines Werkes, das Gebot der Pietät gegenüber früheren Generationen durch Pietät gegenüber ihren Hervorbringungen – ich wollte zeigen, dass die Postulate der Ethik schon alt sind.
III. Pietät
Unter dem Stichwort Pietät nehme ich Gedankengänge auf, die ich erstmals 1972 in der Architekturzeitschrift Werk veröffentlichte, im Sommer 2002 an einer Fachtagung in Baden vortrug, dann auf Französisch an der Jahresversammlung 2008 der Sektion Kanton Jura des Schweizerischen Heimatschutzes präsentierte und kurz darauf publizierte. (31)
Ich gehe das Thema von hinten an und beginne mit der Kritik an der Denkmalpflege-Gesetzgebung in der Schweiz. Ich möchte zeigen, dass sich der Gesetzgeber in der Regel nicht von der Denkmal-Ethik leiten lässt, sondern von einem wie ich glaube veralteten Geschichts- und Kunstbegriff. In der Gesetzgebung werden nämlich die Denkmäler und vor allem die Baudenkmäler als Zeugen oder Zeugnisse der Geschichte von besonderer Bedeutung oder von besonderem Wert definiert.
Ich gebe drei Beispiele. Erstens: In der Kulturdenkmäler-Verordnung des Kantons Solothurn vom 19. Dezember 1995 heißt es in § 2: „Als historische Kulturdenkmäler gelten Werke früherer menschlicher Tätigkeit sowie Zeugnisse der Vergangenheit, die eine besondere archäologische, geschichtliche, soziale, künstlerische, städtebauliche, technische, wissenschaftliche oder heimatkundliche Bedeutung haben.“ Zweitens: Das freiburgische Gesetz über den Schutz der Kulturgüter vom 7. November 1991 setzt in § 3, Alinea 1, fest: „Der Ausdruck Kulturgut bezeichnet ein unbewegliches oder bewegliches, geschichtliches oder zeitgenössisches Objekt, das für die Allgemeinheit als Zeuge der geistigen Tätigkeit, des Kunstschaffens oder des gesellschaftlichen Lebens von Bedeutung ist.“ Drittens: Das Denkmalpflegegesetz des Kantons Bern vom 8. September 1999, verzichtet bei der Begriffsbestimmung in Art. 2 auf die Wörter „Zeuge“ und „Zeugnis“ und stützt sich auf den „besonderen kulturellen, historischen oder ästhetischen Wert“.
Betrachten wir den bildhaften Ausdruck „Zeugen der Geschichte“ etwas näher. In der Rechtsprechung dienen die Zeugen der Wahrheitsfindung. Nicht anders war es in der älteren Geschichtsschreibung. Im Jahre 1752 schrieb der Historiker Johann Martin Chladenius kurz und bündig: (32) „Zeugen sind nur denn nöthig, wenn der Geschichte widersprochen wird.“ Gewiss schreiben wir Geschichte heute anders als vor 250 Jahren. Aber der Satz des Chladenius hat seine Gültigkeit behalten. Zurück zur Rechtsprechung, wo die Zeugen leibhaftig auftreten.
In der Rechtsprechung stehen die Zeugen neben anderen Beweismitteln, wie Augenschein und Urkundenbeweis. Aus juristischer Sicht heißt Urkunde im weiteren Sinn jeder Gegenstand, der Spuren einer rechtlich erheblichen Tätigkeit darbietet, die auf Überlieferung zielt. Beispiele: in der frühen Neuzeit Zeit zwei Ausfertigungen eines Vertrags, die kurvig auseinander geschnitten und bei Rechtshändeln zusammengefügt werden, die Anbringung des Stifterwappens am Kirchenbau oder der Hoheitszeichen auf gemeinsam gesetzten Grenzsteinen. Im rechtlichen Sinne sind Stifterwappen und Grenzsteine nicht „Zeugnisse der Geschichte“, sondern auf Deutsch „Urkunden“.
Beim Augenschein geht es um Gegenstände, aus deren Wahrnehmung sich eine Tatsache beweisen lässt. Wenn möglich wird davon ein Protokoll aufgenommen und von glaubwürdigen Zeugen unterzeichnet. Was wir „Zeugen der Geschichte“ nennen, könnte in Analogie zur Rechtsprechung „Beweismittel der Geschichtsforschung“ heißen. Wir würden uns durch den Oberbegriff „Beweismittel“ der leidigen Metonymie „Zeugen“ entledigen, die ursprünglich Personen statt Sachen meint, und wir wären auch die „Zeugnisse“ los, die eigentlich eine bewusste Aussage von Personen, der Zeugen eben, bezeichnen.
Die Archäologen, deren Untersuchungen in vielen Fällen ihren Gegenstand zerstören, legen großen Wert auf Tagebücher, Vermessungen, zeichnerische Aufnahmen und Fotografien. Diese übernehmen die Aufgabe von Protokollen. Wenn der Augenschein nach einem Verkehrsunfall protokolliert ist, wenn bei einer archäologischen Untersuchung der Befund dokumentiert ist, wird der Platz geräumt.
Die vorgeschlagene Änderung der Nomenklatur – Beweismittel statt Zeugnis – eröffnet neue Blickwinkel. Sie erleichtert die Lösung des Problems, auf welche Art, wie lange und in welcher Auswahl die bisher als „Zeugnisse der Geschichte“ geltenden Artefakte aufzubewahren seien, indem der neue Name eine bestimmte Qualität, die Eignung als Beweismittel, in den Mittelpunkt rückt und von allen anderen Qualitäten absieht.
Mit guten Gründen erlässt der Gesetzgeber für die öffentliche Verwaltung, für die private Geschäftsführung und für die Prozessordnung in der Rechtsprechung Vorschriften über die Aufbewahrung von Akten. Bundesarchiv, Kantonsarchive und kommunale Archive übernehmen die von der Verwaltung periodisch oder nach Bedürfnis abgelieferten Akten, sind aber in vielen Fällen gezwungen, einzelne Bestände nach verschiedenen Kriterien auszuscheiden. Bei Massengut kann nach mathematischen Verfahren sichergestellt werden, dass die Auswahl repräsentativ ist. Als Beispiel nehme ich die Krankengeschichte eines Universitätsspitals, die nach dem Alphabet der Patientennamen abgeliefert werden und von denen man nur die von Personen aufbewahrt, deren Name mit M beginnt. Die Triage wird in der Regel von Archivdirektoren und Archivbeamte vorgenommen, die als Historiker ausgebildet sind und die Statistiker beiziehen. Die Archäologen wiederum hüten zunehmend Dokumentationen statt Objekte. Doch zurück zu den Archivaren!
Die schweizerische Fichenaffäre und die nachfolgende Fichenvernichtung sowie die Tätigkeit der so genannte Bergier-Kommission haben uns gelehrt, wie heikel das Geschäft nicht nur der Aktenauswertung, sondern auch der Aktenvernichtung sein kann, wenn es um die Klärung von Schuld und Unschuld von Jahrzehnte zurückliegenden Handlungen und Unterlassungen geht. Rechtswesen und Geschichtsschreibung verquickten sich dabei in ungewohnter Weise.
Wir kommen hier an einen heiklen Punkt. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Geschichte den Wissensdurst vieler Menschen befriedigt. Dass diese Art von Historie erst seit rund 250 Jahre existiert und auf unseren Kulturkreis beschränkt ist, hat sich als Theorie etabliert und als Tatsache herumgesprochen. Der Nutzen der Geschichte für das politischen Leben und die Kultur im engeren Sinn wird jedoch verschieden gesehen. Den einen ist sie säkularisierte Theologie, den anderen ein Instrument der Nationalstaatenbildung und -führung, den dritten Kompensation des Traditionsverlustes und der Beschleunigungserfahrung, den vierten ein Mittel, im Individuum das Bewusstsein zu erweitern und die Sozialkompetenz zu erhöhen. Jacob Burckhardt meinte, sie vermöge die Menschen zwar nicht klüger, aber reifer zu machen, denn: „Reif sein ist alles“; es gehe darum „weise (für immer)“ zu werden. (33)
Ich will damit andeuten, dass Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung einen gesellschaftlichen, d. h. einen öffentlichen, in aller Regel staatlichen Auftrag haben, der an das öffentliche Interesse gebunden ist. Dieses kann und darf periodisch in Frage gestellt werden. Bei solchem Anlass müssen die historischen Disziplinen nicht allein ihre Zielsetzung überdenken und als öffentliches Interesse glaubwürdig machen, sondern auch zeigen, dass sie die ihr anvertrauten Mittel ökonomisch einsetzen. Dazu gehört der Nachweis einer sachgerechten Triage der Beweismittel der Geschichte.
Die meisten Gesetzgeber in der Schweiz haben ja, wie gesagt, den Denkmalbegriff auf die Materialien der Geschichtsschreibung eingeengt, und sie folgen damit einem internationalen Trend. Diesen Prozess hier darzustellen, das würde die Grenzen eines Grundkurses überschreiten. Mir kommt es auf Folgendes an. Die affektive Bindung von Menschen an ihre Denkmäler zeigt sich in der Gesetzgebung ausschließlich auf dem Weg über die Geschichte, die eine wissenschaftliche Disziplin ist, und über die Vergangenheit oder, noch diffuser, die Gesellschaft, die als deren Gegenstand betrachtet werden, oder schließlich die Kultur, ein wahres Jekami der multikulturellen Menschheit.
Gemeint ist in vielen Fällen, und zuweilen wird es auch hinreichend deutlich ausgesprochen, die Kunst, in unserer Betrachtung das Bauwerk als Kunstwerk. Damit haben wir eine in ihrer Definition zwar umstrittene, aber an keinen Zweck gebundene Sachgruppe vor uns. Gleichgültig ob wir den Akzent auf die formalen oder auf die expressiven Qualitäten von Kunstwerken setzen, so lässt sich doch häufig im Einzelfall zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Konsens erzielen. Auf lange Sicht hingegen sind die Meinungsschwankungen riesig. Architektur ist in der Rezeption wie in der Produktion den Moden unterworfen. Gotische, barocke, historistische, funktionalistische Bauwerke erweckten nacheinander den größten Abscheu – wenigstens unter Gebildeten.
Lassen Sie mich noch ein wenig weiter über die Sachgruppe der Bau- und Kunstdenkmäler räsonieren. Diese Kategorie von Objekten ist keinesfalls identisch mit der Kategorie der Beweismittel der Geschichte, die man Zeugen oder Zeugnisse der Vergangenheit zu nennen gewohnt ist, auch wenn recht viele Bau- und Kunstdenkmäler zugleich der Kategorie der Beweismittel der Geschichte angehören. Die drei angeführten Gesetze der Kantone Freiburg, Solothurn und Bern zeigen durch das Bindewörtchen „oder“ an, dass jeweils nur eine der Bedingungen der „Denkmalhaftigkeit“ oder „Denkmalfähigkeit“ erfüllt sein muss, um die Schutzwürdigkeit zu statuieren. Ich zitiere Ihnen nochmals das solothurnische Gesetz von 1995: „Als historische Kulturdenkmäler gelten Werke früherer menschlicher Tätigkeit sowie Zeugnisse der Vergangenheit, die eine besondere archäologische, geschichtliche, soziale, künstlerische, städtebauliche, technische, wissenschaftliche oder heimatkundliche Bedeutung haben.“
Bei den Bau- und Kunstdenkmälern ist unsere Sorgepflicht so evident, dass wir geneigt sind, sie als Gegenstände der Sorgepflicht zu definieren. Doch ich frage: Was bewegt uns, was bewegt viele Menschen, was bewegt die öffentliche Hand zur Pflege und Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler? Die Fachleute deutscher Zunge haben sich angewöhnt, dafür eine Reihe von Werten ins Feld zu führen, die der berühmte österreichische Kunsthistoriker Alois Riegl um 1900 formuliert und in eine einleuchtende Ordnung gebracht hat. Davon pflegt ausführlicher im Modul „Geschichte und Theorie der Denkmalpflege“ die Rede sein. Einem von Alois Riegls Werten, den Alterswert, sind wir bereits begegnet.
Der österreichische Kollege Norbert Wibiral hat 1983 den Vorschlag gemacht, das Wort „Interesse“, das Riegl weit gehend synonym mit „Wert“ verwendete, für das Verständnis der Kategorie der Bau- und Kunstdenkmäler einzusetzen. (34) Der Begriff „Interesse“ beinhaltet Auswahl in der Wahrnehmung und bei der Zuwendung. Er liegt auch dem Terminus „öffentliches Interesse“ zugrunde. Wibiral unterstreicht, dass das öffentliche Interesse an einem Bau- oder Kunstdenkmal in Konkurrenz zu anderen öffentlichen Interessen tritt und von der politischen oder richterlichen Behörde gegen diese abzuwägen ist.
Nach meiner Überzeugung liegt das Motiv für das Interesse an Bau- und Kunstdenkmälern in der Tugend der „Pietät“. (35)
„Pietät“ heißt zunächst die liebevolle Ehrfurcht gegenüber den Eltern und anderen des Respekts würdigen Personen. Im alten Rom wurde Pietas als Gottheit verehrt. Pietas ist die römische Tugend der Pflichterfüllung gegenüber den Göttern, dem Vaterland, den Eltern und den Kindern, ja gegenüber jedem Mitbürger und den Bürgern fremder Provinzen. Sie umfasst aber nicht allein aufeinander angewiesene lebende Personen, sondern auch vergangene Geschlechter und Zeichen zu deren Erinnerung. Jedenfalls ahndete das kaiserzeitliche Rom die Plünderung von Grab- und Baudenkmälern mit Strafen und mit dem Gebot der Wiederherstellung. (36)
Im Ersten Timotheusbrief des Apostels Paulus (Kap. 6) steht griechisch eusebeia oder lateinisch „pietas“ als christliche Tugend in einer Reihe mit „iustitia“, „fides“, „caritas“, „patientia“ und „mansuetudo“; ich übersetze frei und ohne Rücksicht auf die theologische Übersetzertradition: Gerechtigkeit, Treue, Barmherzigkeit, Geduld und Mäßigung. Antike und christliche Tugendlehre überschneiden sich und verschmelzen, nicht erst in der Renaissance, sondern, wie der Apostel Paulus zeigt, bereits am Ende der Antike zu einem neuen Tugendkatalog mit „iustitia“, „fides“, „caritas“, „patientia“, „mansuetudo“, „pietas“. Die theologische Übersetzung „Frömmigkeit“ für „pietas“ trifft den antiken und damit auch den neutestamentlichen Sprachgebrauch viel weniger genau als das Fremdwort „Pietät“.
Das uns geläufigere Fremdwort „Respekt“ tut es auch nicht. Respekt ist eine Haltung, die ebenso sehr von den Umständen erzwungen wie aus innerer Notwendigkeit entstanden sein kann. Wir sagen von einer stattlichen Burg, von einem imposanten Menschen oder von einer besonderen Leistung sie sei „Respekt einflößend“. Umgekehrt vermag uns die unerwartete Respektlosigkeit eines Menschen zu zeigen, dass Respekt eine Haltung, nicht ein Charakterzug und schon gar nicht eine Tugend ist. Aber Respekt kann ein Ausfluss der Tugend der Pietät sein.
Pietät hat nämlich einen engen Horizont. Sie bezieht sich zunächst auf die Familie und die Verwandtschaft, dann auf die Mitbürger oder – beim Apostel Paulus – auf die Glaubensgenossen. Davon abgeleitet bezieht sich Pietät auf alles, was diesen heilig ist und heil bleiben soll. Wie aber verhält es sich mit dem, was denjenigen Menschen heilig ist, mit denen mich nichts verbindet als das Menschsein? Soll ich – mit Verlaub – für eine Moschee Pietät empfinden, die einem Muslim heilig ist? Ich vermag das nicht, aber meine Toleranz gebietet mir, seiner Pietät mit Respekt zu begegnen. Die neueren Empfehlungen und Richtlinien von UNESCO und Europarat berücksichtigen diesen Umstand, indem sie die Auswahl von Schutzobjekten den damit befassten Gesellschaften und Gemeinschaften übertragen.
Ich gebe noch ein Beispiel für den Respekt vor Pietät aus dem 19. Jahrhundert und völlig außerhalb der Denkmälerpflege. Der im französischen Exil lebende deutsche Republikaner Jakob Venedey beobachtete 1837 in seinem Buch Reise- und Rasttage in der Normandie, (37) dass der Normanne vom Apfelbaum, dem „Brotbaum der Normandie“, „mit einer Art Pietas spricht“; nicht allein die Schönheit blühender Apfelbäume, sondern die vielfältige Verwendbarkeit der Äpfel selbst erkläre „die Pietät der Normannen für den arbre de mon pays“.
Nach diesem kleinen Exkurs sei wiederholt: Ich sehe als Beweggrund für das Interesse an Bau- und Kunstdenkmälern die Tugend der Pietät. Wir bekämen damit eine Erklärung dafür, dass auch weit zurückliegende Zeiten Bau- und Kunstdenkmäler geschützt und gepflegt haben, und zwar nachweislich weit über den praktischen Nutzen hinaus. Doch das sind Spekulationen, die uns bereits wieder aus dem Gebiet der Denkmalpflegeethik hinausführen.
Georg Mörsch und andere sprechen von der „affektiven Bindung“ der Menschen an ihre Denkmäler. Wie allgemein ist diese Beobachtung? Affektiv, gefühlsbetont, emotional ist mindestens die Bindung der Menschen an ihre eigenen und eigensten Erinnerungsstücke, im persönlichen Bereich, im Kreis der Familie und von deren Generationenfolge, dann auch als Zeichen von Gemeinschaften, denen wir längere Zeit angehören oder angehört haben. Der Verlust durch Zufall, Unglück oder Böswilligkeit, Denkmalverlust und Denkmalzerstörung, bilden sozusagen die Neunerprobe der Behauptung, die Bindung der Menschen an ihre Denkmäler sei affektiv.
Es ist ein Gebot der Ethik, die affektive Bindung anderer Menschen an ihre Denkmäler zu respektieren. Denkmalschutzerlasse und multinationale Verträge haben in historischer Zeit dem Gebot des Kulturschutzes in bewaffneten Konflikten Nachachtung zu verschaffen versucht. Nicht immer mit Erfolg, wie die Weltkriege des 20. Jahrhunderts gezeigt haben. Gleichsam zum Trost nenne ich ein frühes teilweise erfolgreiches Beispiel.
Im Österreichischen Erbfolgekrieg belagerten die Franzosen die Stadt Freiburg im Breisgau. (38) „Die Stadt hatte dabei die zweifelhafte Ehre, dass König Ludwig XV. am 11. Oktober 1744 persönlich hier ankam, um die Kämpfe von der Höhe des Lorettoberges aus zu verfolgen. Zuvor hatten die beiden Parteien eine Vereinbarung getroffen, die einerseits dem Schutz des Königs, andererseits dem des Münsters dienen sollte: ,Auch ist von der beiderseitigen hohen Generalität bedungen worden, dem Münster zu schonen; hingegen hatten unsere Artilleristen den Befehl von Damnitz, daß kein Stückschuß auf das Loretto-Bergle geschehe, weil der König selbst dort der Belagerung zusehen werde, obwohl kurz zuvor ein Kunstäbler vom obern Schloß in selbes ein Kugel geschossen.‘“ Der König kam heil davon, das Münster jedoch erlitt Schäden.
Ich kehre zu meinem Steckenpferd „Pietät“ zurück. Die affektive Bindung an einen Gegenstand der persönlichen Erinnerung reicht natürlich nicht aus, ihn zum Denkmal zu erklären, das den Schutz der Öffentlichkeit verdient. Erst die affektive Bindung einer hinlänglich großen Zahl von Menschen konstituiert das öffentliche Interesse, das den Gesetzgeber und die Vollzugsbehörden auf den Plan ruft. Und wiederum liegt es in der Natur der Rechtsstaatlichkeit, dass Gesetzgeber und Vollzugsbehören, Legislative und Judikative, nach Kategorien und Kriterien suchen, um Denkmalschutz und Denkmalpflege in ordentliche Bahnen zu lenken. Warum aber sollen affektive Bindung und als ihr Beweggrund die Pietät hier keinen Platz finden? Zum Vergleich: Elternmord wird besonders hart bestraft, und die Gesinnung des Täters ist im Strafprozess ein Kriterium für das Strafmaß.
Als ich im Sommer 2002 meine Gedanken über Pietät an der genannten Fachtagung des ICOMOS Schweiz vortrug, warf Georg Mörsch in der Diskussion ein, man dürfe die gründlich ausgedachten und sorgfältig redigierten Gesetzestexte nicht einfach wegwischen, die Kriterien des historischen und ästhetischen Wertes seien für den Denkmalbegriff konstitutiv kurz mein Vorschlag, sie durch Pietät zu ersetzen, sei nicht „justiziabel“. Ich beobachte jedoch, dass die Justiz des Begriffs der Pietät auf die Dauer nicht entraten kann, wenn es um den Totenfrieden geht, solange dieser als Rechtsgut gilt. (39) Dieses ist im Schweizerischen Strafgesetzbuch nach Artikel 262 geschützt. Das Transplantationsgesetz regelt diese Frage in Artikel 8 und schützt bei Organentnahme an Verstorbenen die Pietätsgefühle der Hinterbliebenen. Anders sieht das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ein 67-jähriger Westschweizer wollte die Leiche seines mutmaßlichen Vaters exhumieren lassen, um mit dem DNA-Test seine Abstammung zu überprüfen. Dem widersetzten sich die Angehörigen, von drei schweizerischen Instanzen geschützt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wertete dagegen das individuelle Recht, die eigene Abstammung kennen zu lernen, höher. (40)
In unserem Zusammenhang lässt sich der Schutz des Pietätsgefühls vielleicht als Richtschnur dafür nehmen, wer für die Schutzwürdigkeit zuständig und für den Schutz der Denkmäler verantwortlich ist. Eine Zentralbehörde, eine Lokalbehörde, ein Fachgremium, eine politische Instanz? Die scheinbar objektiven Kriterien des historischen und ästhetischen Wertes erweisen sich bald einmal als Machtinstrumente einer Zentralbehörde, die Gefahr läuft, die Fühlung mit den Menschen zu verlieren, denen Bau- und Kunstwerke Gegenstände der Pietät sind. Exemplarisch hat das in den letzten Jahren in mehreren Schriften Jean-Michel Leniaud für Frankreich gezeigt (41).
Denkmalpflege, das ist eine Überzeugung, die ich mit vielen Kollegen teile, erschöpft sich nicht in dem, was das Gesetz vorschreibt und die Fachstellen durchführen. Denkmäler wurden geschützt und gepflegt, ehe es solche Fachstellen gab, und die bestausgebaute Fachstelle ersetzt auch heute nicht den Bürgersinn, der selbst für die kleinen Bau- und Kunstdenkmäler zu sorgen und sich einzusetzen bereit ist. Darum bin ich wie Martin Fröhlich aus Überzeugung Mitglied des Schweizerischen Heimatschutzes und anderer nichtstaatlicher Organisationen, die sich mit Schutz und Pflege von Bau- und Kunstdenkmälern befassen.
Zum Schluss dieses Kapitels sei noch einmal die Einleitung jener gegen 1520 verfassten Gründungsurkunde der neuzeitlichen öffentlichen Denkmalpflege angeführt, der Denkschrift, die man dem Maler und Architekten des St.-Peters-Doms in Rom, Raffael, und seinen Beratern zuschreibt und die sich mit großer Wahrscheinlichkeit an Papst Leo X. wenden sollte:
Gleich wie für jeden einzelnen die Pietät gegenüber den Eltern und dem Vaterland Pflicht ist, ebenso fühle ich mich verpflichtet, alle meine geringen Kräfte daran zu setzen, dass soweit als möglich ein Stück von dem Bild lebendig bleibe oder vielmehr der Schatten dessen, was in Wahrheit das Vaterland aller Christen ist, welches einst so vornehm und mächtig war, dass die Menschen zu glauben begannen, dieses einzige Reich stehe über dem Schicksal und sei gegen den Lauf der Natur dem Tod entzogen, um zu dauern in Ewigkeit.
Der Verfasser zählt die jüngsten Schäden auf, verschweigt aber, dass der Neubau des Petersdoms antike Bauten als Steinbrüche ausbeutete, und übergeht damit einen möglichen Zielkonflikt. (42)
In Raffaels Denkschrift zu einer zeitbedingten Problemstellung wendet sich das Interesse einer begrenzten Gruppe von Bau- und Kunstdenkmälern zu. Ich halte jedoch Pietät für das die Jahrhunderte überdauernde Interesse an der Kategorie der Bau- und Kunstdenkmäler überhaupt. Pietät begründet die respektvolle, einen Generationenvertrag begründende Zuwendung zu verwandten, nahe stehenden und verdienstvollen oder zu Opfern gewordenen Menschen (43) und zu den an sie erinnernden Gegenständen, es seien persönliche Andenken, Gedenkstätten, Grabstellen und -stelen, Standbilder, Tempel, Kirchen oder andere öffentliche Bauten, ja selbst Wunderwerke von Technik und Erfindung.
Diese und andersartige Artefakte konstituieren sich, so glaube ich, durch das affektive Interesse, das ich Pietät nenne, als Denkmäler.
IV. Musealisierung
(Abbildung 19) Ich führe das Thema Musealisierung mit zwei Anekdoten ein. Ob sich die Begebenheiten genau so zugetragen haben, wie sie erzählt werden, weiß ich nicht, aber sie illustrieren eine tiefe Wahrheit. Unsere Bilder stammen nicht aus den Museen, von denen die Geschichten erzählt werden, aber das ist gleichgültig.
Hier die erste Anekdote: Eine Bäuerin, welche jahrelang jeden Tag vor einer Madonnenfigur im Kölner Dom gebetet hatte, setzte ihr Gebet auch fort, als die Madonna ins gegenüberliegende Museum überstellt wurde. Die Antwort des Museums auf die betende Bäuerin im Museum war ein Erlass, welcher beinhaltete, es sei verboten, im Museum zu beten.
(Abbildung 20) Der umgekehrte Fall ereignete sich, als der Kölner Dom nicht als Ort des Gebetes, sondern für kunstwissenschaftliche Betrachtungen genutzt wurde. Ein Student, welcher vor dem Gero-Kreuz auf dem Absperrgitter Platz genommen hatte, wurde vom Küster mit den Worten „Hier wird nicht gesessen, hier wird gekniet“ auf die Sakralität des Ortes verwiesen. (44)
Als langjähriger Museumsmann bespreche ich diese und weitere Beispiele von Musealisierung von Denkmälern, indem ich die Sicht der Museumspräsentation mit der Sicht der Denkmalerhaltung zu verbinden suche.
„Musealisierung“ eines Gegenstandes heißt ihn zum Museumsobjekt oder gar selbst zum Museum machen. Es handelt sich um eine ungewöhnliche Form von Umnutzung.
Indem man die Muttergottesfigur aus dem erzbischöflichen Dom von Köln in das nahe gelegene Diözesanmuseum verbrachte und dort als Zeugnis oder Denkmal oder Überrest oder Reliquie oder Beispiel christlicher oder abendländischer oder gotischer oder mittelalterlicher Kultur, wenn nicht als volksnaher katholischer oder ökumenisch-christlicher Kunst aufgestellt hat, wird sie musealisiert. Selbst für den Domherrn, der das Diözesanmuseum leitet, ist sie dann in unserer Anekdote als Bild der Himmelskönigin und Fürbitterin am Jüngsten Tag so weit entrückt, dass ihn in ihrer Nähe das fromme Gebet stört. Dass dies dem Domherrn als Museumsmann widerfuhr, will ich gerne glauben, dass er das Ärgernis zum Anlass nahm, ein förmliches Gebetsverbot zu erlassen, halte ich für eine bösartige Erfindung des Anekdotenerzählers.
Warum sollen denn die zwei Nutzungen unvereinbar sein? Waren die Besucherwege in dem damaligen Diözesanmuseum (das neue ist von Peter Zumthor) so eng angelegt, dass die Kniende ein Hindernis darstellte? Schämte sich der gelehrte Domherr der Volksfrömmigkeit der Diözesankinder? War er ein verkappter Bilderstürmer, der die Madonna durch die Verbringung ins Museum dieser Volksfrömmigkeit hatte entziehen wollen? Ich weiß keine Antwort, sondern füge eine kleine Begebenheit aus meinem Berufsleben an, aus der sich die Perspektive der Volksfrömmigkeit ableiten lässt.
(Abbildung 21) Als ich den 1960er-Jahren im Bezirk Muri des Kantons Aargau inventarisierte, genoss ich Vertrauen und Hilfe der Geistlichkeit. Ein Benediktinerpater, P. Vigilius, damals Pfarrvikar, verriet mir den Standort eines hölzernen Kruzifixus an der Giebelwand eines abgelegenen Bauernhauses im Weiler Kallern und begleitete mich dorthin. Der Eigentümer half mir den Kruzifixus abhängen, ließ mich ihn in aller Ruhe untersuchen, dann hängten wir ihn wieder an seinen Platz, damit er weiterhin seinen Abwehrzauber ausübe. Dort habe ich ihn, so gut es ging, fotografiert. Wir unterhielten uns noch kurz über den Marktwert. Die Nachbarn hätten nämlich einen hölzernen St. Andreas gehabt und verkauft; der Verkauf habe ihm aber kein Glück gebracht. Inzwischen ist der Kruzifixus an das Schweizerische Landesmuseum verkauft worden, das möglicherweise durch meine Publikation darauf aufmerksam wurde. Ob er dem Verkäufer Glück oder Unglück brachte, weiß ich nicht.
Der Kruzifixus stammt aus dem 14. Jahrhundert. Er stand einst wohl auf einem Chorbogenbalken. Im Skulpturenband der Bücherreihe Ars Helvetica (VII, 1992, Abb. 72) ist er vor hellem neutralem Hintergrund abgebildet, so museal wie nur möglich.
(Abbildung 22) Wenden wir uns zum Kölner Dom zurück. Das Gerokreuz ist ein lebensgroßes Holzbildwerk, das Erzbischof Gero um 970 gestiftet haben soll und dessen dendrochronologische Untersuchung im Jahre 1976 diese Entstehungszeit bestätigte. Für Kunsthistoriker handelt es sich um ein unvergleichliches Spitzenwerk ottonischer Kunst. Für Studierende der Kunstgeschichte ist es Gegenstand heikler Examensfragen. Vor diesem Gerokreuz also lässt die Anekdote den Domschweizer (so nennt man dort die Aufseher) einen Studenten der Kunstgeschichte maßregeln, weil er sich, vielleicht um Notizen zu machen, auf die Schranke gesetzt hat. Indem er das macht, macht er den Dom zum Museum. Es ist natürlich nicht der Perspektivewechsel, der den Ordnungshüter auf den Plan ruft, sondern die Verletzung einer Verhaltensregel, überdies in einem kirchlichen Innenraum, der mit jährlich über einer Million Besucher touristisch übernutzt wird.
(Abbildung 23) Man könnte denken, in einem zum Museum gemachten Kloster sei die Kluft geringer. In Nürnberg besteht der Kern des Germanischen Nationalmuseums aus dem ehemaligen Kartäuserkloster. Der Plan von 1860 zeigt die ersten Veränderungen, besonders deutlich in den Grünanlagen. (Abbildung 24) Das folgende Bild zeigt den Chor der Klosterkirche, wie er 1880 mit kirchlichen Gegenständen ausgestattet wurde, allerdings mehr klassifikatorisch als ambiental. Das war im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin zu der Zeit, da unsere dritte Anekdote spielt, bereits anders. Der große Renaissanceraum stellte gleichsam eine florentinische Basilika mit Seitenschiffen und Seitenkapellen dar. Karl Scheffler schreibt: „In der Basilika befinden sich zu beiden Seiten Altarnischen mit italienischen Altargemälden, während in der Mitte ein geschnitztes Lesepult und Chorgestühl den Charakter des Kirchlichen noch verstärken. Diesen Raum betrat eine italienische Prinzessin und warf sich vor einem der Madonnenbilder nieder, um zu beten. Als ein Galeriediener sie daran hindern wollte, schlug sie Lärm und beschwerte sich beim Minister.“ Jetzt kommt der gedankliche Salto mortale des Kunstfreundes Karl Scheffler, für den Kunst letztlich nur Kunst ist. „Diese Italienerin“, fährt er fort, „war ein naiver Mensch, aber die, die sie verlachten, waren schon so instinktlos und verdorben, dass sie den eigentlichen Sinn eines Dings nicht mehr begriffen. Es ist nicht wahr“, sagt Scheffler nun, „dass die alten Kunstwerke an ihrem ursprünglichen Standort am besten ausgesehen haben und dass dieser irgendwie vorgetäuscht werden muss, sie haben am besten in der Werkstatt ausgesehen. Wenn man bei der Ausstellung wieder diese Wirkung erzielen kann, ist das Höchste erzielt.“ (45) Schefflers Ideal ist das isolierte Kunstwerk als Schöpfung eines Meisters, nicht das für einen bestimmten Zweck und für einen bestimmten Platz geschaffene Werk; sein Ideal ist eben die Atelier-, Kunsthalle- und Kunstmarktkunst.
(Abbildung 25) Karl Scheffler vertrat zu seiner Zeit die unter Museumsleuten, Sammlern und Kunstgelehrten herrschende Auffassung. Sie schlug sich auch in den Kunstbüchern nieder, wo die Kunstwerke so isoliert wie möglich abgebildet wurden, Bildwerke vor neutralem Hintergrund, Gemälde ohne Rahmen, Architektur ohne Menschen. Ausnahmen waren selten; sie häufen sich jedoch in jüngerer Zeit. So finden wir in Oskar Bätschmanns Buch über den venezianischen Maler Giovanni Bellini, das 2008 erschienen ist, mehr als einmal einen ganzen Altar mit seiner Umgebung abgebildet, so zum Beispiel Bellinis Retabel in Santa Maria Gloriosa de’ Frari in Venedig.
Musealisierung sei eine „ungewöhnliche Form der Umnutzung“, sagte ich eingangs. Ich gehe dabei davon aus, dass es neben der utilitaristischen auch eine „transutilitaristische“ Nutzung gibt. Ich könnte auch von „ideellen Zwecken“ sprechen, aber ich mag diesen Ausdruck nicht.
Es gibt von Menschen geschaffene Gegenstände, denen der bloße Spieltrieb zugrunde liegt. Es gibt Gegenstände, die der Kontemplation, der Meditation, der Erbauung oder der Reflexion dienen. Es gibt Objekte, die zu einem utilitaristischen Zweck gemacht wurden, nun aber privat oder öffentlich aus Pietät, Sentimentalität, Nostalgie, kollektiver oder individueller Zwangsneurose aufbewahrt, gepflegt und vielleicht gezeigt oder ausgestellt werden, eine Sammlung von Bügeleisen zum Beispiel.
Die meisten Kunstwerke aus älterer Zeit, das macht sie als Beispiele der Musealisierung pikant, haben jedoch den einen transutilitaristischen Zweck gegen den anderen getauscht, was für das Kohlebügeleisen im Heimatmuseum nicht zutrifft. Genügt es zu sagen, das Bügeleisen sei ein Sammlungsobjekt geworden? Deckt dieser Begriff, der nichts über den Nutzen und die Nutzung sagt, den Musealisierungsprozess genügend ab? Dieser Frage wollen wir uns nun etwas systematischer zuwenden.
Ich benutze zur Systemordnung zwei Ansätze, den ätiologischen und den phänomenologischen. Ich frage einerseits nach Ursache und Wirkung, andererseits nach den Erscheinungsweisen. Noch einfacher ausgedrückt: Ich frage zuerst „Warum geschieht Musealisierung“?, hernach „Was geschieht durch Musealisierung.“ Ich stütze mich dabei auf die Studie von Eva Sturm.
(Abbildung 26) Wenn Musealisierung als eine Grundtendenz im kulturellen Leben Europas im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts betrachtet wird, dann lohnt es sich zu fragen, was hier das Motiv sei. Jean Baudrillard, der französische Philosoph, (46) schrieb 1978: „Das Museum existiert nun überall als Dimension des Lebens.“ Aber schon 1969 erschienen die Aufzeichnungen des Schweizer Schriftstellers Jürg Federspiel über seinen Aufenthalt in New York unter dem Titel Museum des Hasses, eine lesenswerte Abrechung mit der Musealisierung unter dem ironischen Postulat: „Jedem Menschen sein Museum!“ Hermann Lübbe, Professor an der Universität Zürich, stellte 1982 fest, dass „die Musealisierung unserer kulturellen Umwelt ein historisch beispielloses Ausmaß erreicht hat.“ (47)
Am umfassendsten, doch nicht notwendigerweise am schlüssigsten erklärt die Kompensationstheorie die Motivation für die Konservierung von Gegenständen durch Musealisierung und Denkmalschutz. Die Kompensationstheorie geht auf Joachim Ritter, den Herausgeber des Philosophischen Wörterbuchs, zurück, der sie schon 1963 formulierte. Sie besagt: Der Prozess der Modernisierung in der bürgerlich-industriellen Gesellschaft zog den Verlust von Tradition, eine allgemeine reale Geschichtslosigkeit und das Fehlen von historischem Sinn nach sich. Als Gegenmaßnahme errichtete die Gesellschaft kompensativ Institutionen. Ritter nennt sie „Erinnerungsorgane“, welche helfen sollten, wieder historischen Sinn zu finden. Eine solche Institution ist das Museum. Solange die Kontinuität der Überlieferung nicht abbricht, kann ein solches Defizit nicht entstehen. Ist es einmal da, wird Geschichte etwas Anderes. Der moderne historische Sinn kennzeichnet sich dadurch, „dass er aus solcher unmittelbar zum geschichtlichen Dasein gehörigen Einheit von Geschichte und Historie herausgetreten ist“. (48) „Historie“ meint hier ungefähr die fremd gewordene Vergangenheit.
Die Kunstgewerbemuseen sind aus einer solchen Defiziterfahrung heraus entstanden: einerseits als Vorbildersammlung für Kunsthandwerker und Entwerfer, andererseits als Anschauungsorte des guten Geschmacks für die sonntäglichen Besucher. Das Schweizerische Landesmuseum in Zürich, eröffnet 1898, enthielt bis 1933 auch die Kunstgewerbeschule und das Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich und konnte anfänglich in vielen Teilen auch ohne dessen Mustersammlung die Anschauung von Vorbildern fördern, vor allem in den historischen Zimmern und in den beiden Kapellen. Das Bernische Historische Museum erhielt vor dem Ersten Weltkrieg als wirtschaftsfördernde
Mustersammlung Bundessubventionen.
In den Fußstapfen Joachim Ritters hat Hermann Lübbe in den 1980er-Jahren die Kompensationstheorie weiter ausgebaut; zentraler Begriff ist die „Beschleunigung“, z. B. in der nachfolgenden Beobachtung: „Wer sich heute mit hohem ästhetischem Anspruch avantgardistisch möbliert, wohnt morgen bereits in Ensembles von gestern.“ (49) Lübbe unterscheidet zwischen dem beschleunigten Prozess des Unzeitgemäßwerdens und der kompensativen Hochschätzung des Altgewordenen. Er nennt vier Formen der Vergangenheitsvergegenwärtigung: Musealisierung, Denkmalpflege, Beachtung der Regionalkulturen und allgemeine Historisierung unserer Kultur.
Als Historiker trage ich Bedenken gegen monokausale Erklärungen. Gegen den Anspruch der Kompensationstheorie wäre einzuwenden, dass weder Denkmälerpflege noch Sammeln und Ausstellen Erscheinungen des bürgerlich-industriellen Zeitalters und der Gegenwart darstellen; die Gefäße standen bereit, es galt sie in das bürgerlich-industrielle Zeitalter überzuführen, die Institutionen zu schaffen, die der neuen Gesellschaftsordnung und ihren Verwaltungsformen entsprachen, und schließlich das Sammeln und Konservieren kulturpolitisch zu begründen. Als Erklärungsmodell hat indessen die Kompensationstheorie nicht einfach ausgedient, sie dünkt mich nur zu global.
„Monumentum“, so nennen die Römer seit dem Bau des Pompejustheaters in Rom ein Bauwerk, das den Namen des Stifters über seinen Tod hinaus wach halten soll. Das deutsche Wort „Denkmal“ ist die Lehnübersetzung des lateinischen „monumentum“. Eine weitere Übersetzung ist „Andenken“; dieses Wort bezieht sich jedoch nicht nur auf Gegenstände. Das Wort „Denkmal“ im Zusammenhang mit Denkmalpflege hat eine lange, von Norbert Wibiral gut erforschte Geschichte (1982, 1983). Darauf sollen andere Module des Studiums Denkmalpflege eingehen. Jetzt möchte ich nur darauf aufmerksam machen, dass sich das Wort „Denkmal“, seines metaphorischen Charakters entkleidet hat, jedoch in ganz vertrauten Zusammensetzungen wie „Grabdenkmal“ und „Baudenkmal“ zur ambivalenten erinnernden Bedeutung zurückspringt.
(Abbildung 27) Die Mumie ist ein Leichnam oder Kadaver, dessen Aussehen durch verschiedene Maßnahmen, darunter die Einbalsamierung, dem raschen Zerfall entzogen und erhalten wird. Zuweilen enthält ein Denkmal die Mumie, und in seltenen Fällen – Lenin-Mausoleum in Moskau – kann diese wie eine Reliquie besichtigt werden. Die Mumie ist der Inbegriff der Vergänglichkeitsabwehr; als Schaustück im Museum befriedigt sie voyeuristische Nekrophilie. Aber sind nicht viele andere Museumsobjekte in diesem Sinne Mumien?
Zu den berühmtesten Reliquien des christlichen Mittelalters zählten: das von der Kaiserin Helena, der Mutter Konstantins des Großen, wieder aufgefundene Kreuz Christi, die Martersäule Christi in Rom, die Dornenkrone Christi im Besitz des französischen und die heilige Lanze im Besitz des deutschen Königs, das Gebärhemd der Jungfrau Maria in der Kathedrale von Chartres und schließlich die Gebeine der heiligen Apostel Petrus und Paulus in Rom sowie die des Apostels Jakob in Santiago de Compostela. Bei der Aufbewahrung von und im Umgang mit Reliquien vermischen sich in moderner Perspektive Pietät gegenüber den Toten und magische Vorstellungen auf das seltsamste.
Zeugen sind oft unwillig, Aussagen zu machen. Im Justizprozess besteht die Kunst darin, sie zum Sprechen zu bringen und ihre Aussagen richtig zu interpretieren. Wie sehr trifft das doch auch für Objekte mit Zeugnischarakter zu, und wie leicht unterschieben wir ihnen eine Meinung, die sie nicht geäußert haben! Ich will es noch einmal mit den Worten Baudrillards und Sturms sagen: Musealisierung heißt Entzeitlichung und „historische Zeugenschaft“: „Ständig“, vermerkt Baudrillard, „zwingen wir […] alle vorangegangenen Epochen, alle Lebensformen und alle Mentalitäten dazu, ihre historische Wahrheit zu präsentieren und von sich mittels Beweisen und Hilfsdokumenten zu berichten.“ „Die Entzeitlichung im Neukontext“, fügt Sturm bei, „bedeutet einen materiellen und einen ideellen bzw. symbolischen Sinn- und Funktionsverlust.“ (50)
Dieser pessimistischen Sicht kann ich nicht beipflichten. Zunächst geht es ja um Sein oder Nichtsein des Objekts; dann aber müsste eine korrekte Buchhaltung neben dem Sinnverlust den Sinngewinn bilanzieren. Von solcher Sinngebung und solchem Sinngewinn möchte ich zum Schluss noch ein Wort beifügen. Als Beispiel empfehlen sich musealisierte Häuser, Hausteile und Innenräume. Meine Darlegung wird ganz impressionistisch sein.
(Abbildung 28) Man lässt die Gattung der Freilichtmuseen gewöhnlich mit dem Skansenpark in Stockholm beginnen, der 1891 eröffnet wurde. Das Projekt des Bernischen Historischen Museums von 1890 sah ebenfalls ein Freilichtmuseum vor, und zwar mit Stadt- und Landhäusern. Als der erste Kauf, ein Haus in Interlaken, scheiterte, wurde das Projekt aufgegeben und das Grundstück als Fußballplatz benutzt. Dagegen wurden in der Folge im Ostflügel des Museumsbaues städtische und ländliche Zimmer eingerichtet, mit beträchtlichem sozialem Spektrum. Die Belebung mit Wachsfiguren wurde erwogen, aber verworfen. Die Räume waren anfänglich ohne Ausnahme betretbar und wurden erst nach und nach zu abgesperrten Kojen umgewandelt. Bei der letzten Jeremias-Gotthelf-Zentenar-Feier vor über hundert Jahren dienten die historischen Zimmer als Ausstellungsräume für „Reliquien“ des Schriftstellers; der Ausdruck „Reliquien“ stammt aus den Protokollen von 1897. (51)
Freilichtmuseen, Ökomuseen, Industrielehrpfade und historische Zimmer sind wie Disneyland begehbare fiktionale Welten zu Vergnügung und Belehrung. Fiktional sind sie in jedem Fall, selbst wenn alles so aussieht, als wären die Bewohner nur eben in Urlaub gegangen. Es bleibt beim Als-ob.
Was ist unter dem Gesichtspunkt der Ethik wünschbar, was vertretbar, was strafbar? Das Tagelöhnerhaus mit einer Deckenhöhe von 170 Zentimeter ist als Schauraum eines Freilichtmuseums erlaubt, ja als Demonstrationsobjekt erwünscht; die amtlich erzwungene Erhaltung im bewohnten Haus ist ein Skandal. Ich berufe mich auf das Eisenbahngespräch mit einem bayrischen Landtagsabgeordneten über einen jungen Heimatpfleger, der das nicht einsehen wollte. Das Mischen von Originalobjekten verschiedener Herkunft, mit diskretem schriftlichem Hinweis, ist in meinen Augen kein Unglück, selbst wenn ein Museumsbesucher versehentlich getäuscht wird. Immer sollte jedoch der Charakter der Fiktionalität gewahrt und in Genuss und Belehrung einbezogen werden.
(Abbildung 29) Denn wie rasch landen wir bei der Fälschung, der Vorspiegelung falscher Tatsachen, der Geschichtsklitterung! Da zwingen wir sozusagen das „objet-témoin“ zum falschen Zeugnis und zum Meineid. Ethik aber verbietet Nötigung und Lüge. (52)
V. Authentizität
Im letzten Kapitel sei die Rede von Authentizität als Postulat in der Ethik der Denkmalpflege. Wie weit soll und kann ein Bau- und Kunstdenkmal es selbst bleiben?
Der kanadische Philosoph Charles Taylor veröffentlichte 1992 eine zeitkritische Vorlesung unter dem Titel The Malaise of Modernity; die amerikanische Ausgabe bei Harvard University Press trägt den Titel The Ethics of Authenticity. In diesem Zusammenhang bedeutet Authentizität soviel wie das Ziel der menschlichen Selbstfindung, und sie erscheint als Zerrbild des heutigen Individualismus, ja Subjektivismus. (53) „Authentizität“ lässt sich dann interpretierend übersetzen als „Unverwechselbarkeit“ oder „Einzigartigkeit“.
Doch damit erfassen wir nur einen Teil des Bedeutungsumfangs. „Authentizität ist zu einem Schlagwort von herausragender und zugleich höchst umstrittener Bedeutung geworden“, lesen wir am Beginn einer transdisziplinären Sammelschrift über Authentizität, die im Jahre 2009 erschienen ist. (54) Und weiter: „Von den Wissenschaften über die Künste, von den Medien über die Politik bis hin zum Alltag figuriert der Hinweis auf Authentizität als Akt der Beglaubigung. Was als authentisch qualifiziert wird, trägt das Siegel der Wahrheit, gilt als echt, steht ein für eine nicht hintergehbare Realität. Die Zuschreibung von Authentizität zielt in dieser Weise auf die Verifizierung eines Sachverhalts, der nicht voraussetzungslos gegeben ist, auf die Herstellung und Sicherung einer Verbindlichkeit, die als prekär erfahren wird. Relevanz und Problematik des Authentischen zeichnen sich vor diesem Hintergrund gleichermaßen ab.“ (55)
Die „Zuschreibung von Authentizität“ ist im Übrigen etwas sehr Altes. „Authentik“ nennt man beispielsweise die kirchliche Beglaubigung einer Reliquie; sie hat häufig die Form eines um die Reliquie gewickelten Streifens Pergament mit der Beurkundung.
Der Begriff der Authentizität hat nicht nur Aktualität, sondern auch Pertinenz für die Ethik der Denkmalpflege. Die weithin anerkannte Charta von Venedig von 1964, enthaltend die internationalen Empfehlungen für die Erhaltung und Pflege der Bau- und Kunstdenkmäler, beschließt mit diesem Begriff den ersten Abschnitt ihrer Präambel; die Menschheit heißt es hier, hat die Verpflichtung, kommenden Generationen „die Denkmäler im ganzen Reichtum ihrer Authentizität weiterzugeben“. (56) Weder in der deutschen, noch in der englischen, französischen und spanischen Fassung wird völlig klar, ob der Reichtum in der Verschiedenartigkeit der Denkmäler liegt oder im Facettenreichtum des einzelnen Denkmals. (57) Zunehmend verschiebt sich jedenfalls die kulturpolitische Wortbedeutung von „Authentizität“ in Richtung von „Unverfälschtheit“. Das lässt sich besonders dort beobachten, wo es nicht um die Pflege der Denkmäler geht, sondern um ihre Konstituierung. Am Beispiel gezeigt: Verdient die Berner Altstadt das Gütezeichen „Weltkulturerbe“ noch, wenn hinter den Fassaden radikal neu gebaut wird? Ist die Berner Altstadt dann noch authentisch, unverwechselbar, einzigartig, vor allem: ist sie wirklich noch „unverfälscht“?
Es waren die Ausführungsbestimmungen über die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes, wo „Authentizität“ erstmals 1980 zum wichtigen Kriterium für die Wahl zum Weltkulturerbe wurde. (58) Mit zunehmender Globalisierung entrückten die europäischen Paradigmen von Kirche und Burg aus dem Gesichtskreis der Experten. Außereuropäische Experten forderten schließlich die Anerkennung der „immateriellen Kulturgüter“ als Äquivalent zu den „materiellen Kulturgütern“. Ich kann das verständlicher, aber nicht ohne europäische Arroganz so ausdrücken: die Folklore wird zum Schutzobjekt, und „Authentizität“ wird durch „Tradierung“ ersetzt.
Das in Nara, Japan, im November 1994 verabschiedete Dokument über die Authentizität von Kulturgut hält in seinem Artikel 4 fest:
In einer Welt, die von Globalisierung und Banalisierung überwältigt wird und in der sich die kulturelle Identität zuweilen in aggressivem Nationalismus und in der Ausmerzung der Kultur von Minderheiten äußert, trägt der Authentizität zu allererst Rechnung, wer die ganze Vielfalt des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit achtet und ins rechte Licht rückt, nicht zuletzt durch die Bewahrung des Kulturerbes. (59)
(Abbildung 30) Es kommt jedoch darauf an, welchen Wert wir einem Kulturgut beimessen. Dabei stoßen wir auf das Problem der Deutungshoheit. „Deutungshoheit“ ist ein Fachwort aus der Medienwissenschaft und ein beliebtes Schlagwort in der bundesdeutschen Politik. In unserem Zusammenhang: Wem steht es zu, einem Kulturgut einen besonderen Wert beizumessen und es zu deuten? Ich erläutere die Problematik an einem berühmten Beispiel. Der Bau des jetzigen Kölner Doms wurde 1248 begonnen, und zwar als Kirche des Erzbischofs und des Domkapitels von Köln. Der Bau blieb im 16. Jahrhundert unvollendet liegen, erfüllte jedoch diese Funktion vollkommen, sobald der Chor vollendet und eingeweiht war. Das geschah 1322. Die Funktion als Metropolitankirche wurde erstmals unterbrochen, als die Truppen der damals antiklerikalen Französischen Republik einmarschierten und 1794 der Gottesdienst eingestellt wurde. Von 1801 bis 1821 diente der Dom als Pfarrkirche. Dann wurde durch ein Konkordat zwischen Rom und Berlin das Erzbistum Köln wiederhergestellt und der Dom erneut zur Metropolitankirche; sogleich begann unter preußischer Aufsicht die Instandsetzung.
Während der Befreiungskriege, in denen die deutschen Heere mit Unterstützung ihrer Allierten die napoleonischen Heere schlugen und vertrieben, kam der Gedanke auf, der Kölner Dom sei ein Nationaldenkmal und müsse vollendet werden wie auf politischer Ebene die Vereinigung der deutschen Staaten zu einem einzigen großen Reich. (60) Angeregt durch den frisch gegründeten Kölner Dombauverein, dessen Protektorat er übernahm, legte der preußische König 1842 den Grundstein zum Fortbau. Der Erzbischof nannte in seiner Ansprache als Motive „Religion – Vaterland – Kunst“, der protestantische König drehte die Reihenfolge um: „Vaterland, Religion und Kunst“.
Ein Artefakt wird zum Denkmal durch den Wert, den ihm eine Gemeinschaft oder Gesellschaft beimisst. In den internationalen Empfehlungen heißt diese Wertsetzung „Interpretation“. (61) Es liegt auf der Hand, dass die fremdbestimmte Interpretation und die damit einhergehende Präsentation die Authentizität beeinträchtigen. Generationenwechsel oder Umnutzung erfordern, dass Wertsetzung und Interpretation überprüft werden. Das gehört zu den dynamischen Aspekten der Denkmalwerdung, die ich persönlich bejahe.
Zurück zum Alltag, zu den Bau- und Kunstdenkmälern unseres Landes, von den großen, berühmten bis hinab zu den bescheidenen, der Sorge würdigen und der Pflege bedürftigen Kleinbauten, (62) zurück also zu den Aufgaben, für die man sich am Standort Burgdorf der Berner Fachhochschule rüsten kann. Was bedeutet der Anspruch, authentisch zu sein, für Bau- und Kunstdenkmäler, und – warum ist Authentizität ein Thema der Ethik der Denkmalpflege? Ich benutze den Begriff der Authentizität als Ausgangspunkt für die Rede über Wahrheit und Lüge, Echtheit und Betrug, Original, Kopie und Fälschung.
(Abbildung 31) Ich erläutere die Fragestellung durch ein alltägliches Beispiel. Ich lese in der Zeitung Der Bund vom 1. Oktober 2009, S. 23, die folgende Pressemitteilung: „Das Bieler Bahnhofgebäude aus dem Jahr 1923 ist denkmalgeschützt. Beim Umbau wurden die Originalfarben aus den 1920er-Jahren entdeckt. Das Bahnreisezentrum erstrahlt darum wieder in historischem Blau.“ Weniger emphatisch-propagandistisch ausgedrückt heißt das: Ein Saal im Ostflügel des Empfangsgebäudes, jetzt Bahnreisezentrum, im Bahnhof Biel wurde blau gestrichen, in Anlehnung an die ursprüngliche Farbe. Das Blau ist weder „historisch“ noch authentisch, aber der Farbton erzeugt, ästhetisch betrachtet, weder in dem Bahnhof von 1923 noch zusammen mit zeitgenössischem Mobiliar einen Misston. Wirklich authentisch ist hingegen die zugemauerte Eingangstür neben der neuen automatischen Glasschiebetür, nicht unversehrt, aber unverfälscht. Die Pressenotiz spielt die Rolle einer Authentik für etwas, was bestenfalls im Rang einer Berührungsreliquie steht. Warum machen sich die Schweizerischen Bundesbahnen diese Mühe? Man hat geschrieben, dass heute „Authentizität selbst zu einem bevorzugten Konsumgut wird“, und auf den Tourismus bezogen, dass „die Authentizität kultureller Erfahrungen zielgruppengerecht […] inszeniert und hergestellt wird“. (63) Man darf die Pressenotiz über das Bahnreisezentrum im Bahnhof Biel ohne weiteres in diesen touristischen Zusammenhang bringen und präzisieren, dass touristische Propaganda mit Vorliebe das Fremdartige und Entfernte als authentisch anpreist. Dazu gehört auch das so genannte Historische.
(Abbildung 32) Wir wollen beim einzelnen Kunst- und Baudenkmal bleiben. Den Vätern der Denkmalpflegeethik ging es darum, alle unnötigen Eingriffe zu brandmarken. Statt der berühmten Namen des Grafen de Montalembert, des Dichters Victor Hugo und des gelehrten Journalisten Adolphe-Napoléon Didron zitierte ich den strengsten unter ihnen, den wenig bekannten französischen Beamten Jean-Philippe Schmidt (1809–1840) und sein Büchlein Les Églises gothiques von 1837. Was Schmidt schreibt, passt auf ein damals aktuelles Beispiel, Saint-Ouen in Rouen. (64) Ich übersetze:
Ein Bauwerk erhalten, das bedeutet nicht nur seinem Einsturz zuvorkommen oder ihn aufhalten; die Erhaltung muss sich auch zum Ziel setzen, es in seiner ganzen Integrität an kommende Zeitalter weiterzugeben […]. Man darf nicht glauben, wir hätten den Wunsch oder spielten mit dem Gedanken, die Behörden dazu aufzufordern, unseren mittelalterlichen Kirchen ihre ursprüngliche Integrität zurückzugeben und sie mit ihrem alten Glanz zu bekleiden. Wir fordern lediglich, dass man instand setze, was sich erhalten hat, dass man es so repariere, dass sein hinfälliges Aussehen verschwindet, doch ohne dass es die Anzeichen des Alters verliert, die es so ehrwürdig machen […]. Auch müssen wir es uns außer bei dringendem Bedarf versagen, ein Bauwerk zu vollenden, welches das Jahrhundert, das es gebar, unvollendet zurückließ. (65)
Statt mit „Integrität“ hätte ich das französische intégrité auch mit „Authentizität“ übersetzen können. Schon bald, in den 1840er-Jahren, sollten wortmächtigere Liebhaber der Architektur die Forderungen von Jean-Philippe Schmidt aufnehmen, verfeinern und mit Begründungen hinterlegen, so in England John Ruskin und in Deutschland August Reichensperger, übrigens ohne Schmidt zu erwähnen und wahrscheinlich auch ohne ihn zu kennen. (66) Das alles liegt weit zurück, wie bei Schmidt allein schon die Beschränkung auf den Kirchenbau zeigt. Schmidts und Reichenspergers Ethik beruft sich auf ihre römisch-katholische Frömmigkeit, diejenige John Ruskins, der nach dem Wunsch seiner Mutter presbyterianischer Priester werden sollte, speist sich von christlich gefärbter Pietät und eigentlicher Kunstfrömmigkeit. Weder Ruskin noch Reichensperger fordern eine staatliche Denkmalpflege, sondern beide mahnen die jeweils zuständigen Behörden an ihre Unterhaltspflicht. Angesichts der am Anfang des 19. Jahrhunderts neu geregelten Zuständigkeiten im Bauunterhalt warnen sie einstimmig vor unnötigen Eingriffen, weil diese die Authentizität von Bau- und Kunstdenkmälern beeinträchtigen und sie verfälschen.
(Abbildung 33) Im Kapitel über Pietät als Grundmotiv der Denkmälerpflege wies ich darauf hin, dass sich der Gesetzgeber in der Regel von einem wie ich glaube veralteten Geschichts- und Kunstbegriff leiten lässt. In der Gesetzgebung werden nämlich die Denkmäler und vor allem die Baudenkmäler als Zeugen oder Zeugnisse der Geschichte von besonderer Bedeutung oder von besonderem Wert definiert. Das hat einerseits Folgen für die Auswahl schutzwürdiger und geschützter Denkmäler, andererseits auf ihre Instandhaltung und ihre Instandsetzung, ja selbst ihre Entlassung aus dem Schutz. Der traditionelle, von mir als veraltet taxierte Kunstbegriff der Denkmalpflege-Gesetzgebung ersetzt „echt“ durch „original“, das heißt ursprünglich oder auch eigenhändig, am deutlichsten in den Substantiven „das Original“ im Gegensatz zu „die Kopie“ oder „die Replik“. Von den Veränderungen gelten nur die naturbedingten als erträglich; die Patina, die ehrwürdiges Alter und langjährige Unberührtheit zu garantieren scheint, ist geradezu erwünscht. Gemäß diesem Kunstbegriff sind Veränderungen rückgängig zu machen, ja um den Schein der Unberührtheit zu erhalten, durch neue Ergänzungen zu ersetzen. Das klassische Beispiel sind die Ergänzungen von antiken Marmorskulpturen – ich denke dabei an die antike Kriegergruppe aus Ägina in der Glyptothek von München – und die Turmvollendungen – ich denke dabei an die Münster von Ulm und Bern oder die Jesuitenkirche in Luzern. Ethik und Ästhetik widersprechen einander.
Ich habe schon angedeutet, dass der künstlerische Wert und der historische Wert eines schutzwürdigen oder geschützten Gegenstandes auf ganz verschiedene Weise „authentisch“, „echt“, „unverfälscht“, „original“ sein können, dass menschliches Eingreifen sie jedoch auch auf viele Arten verfälschen kann und dass den Denkmälern von ganz verschiedener Seite her der Verlust der Authentizität droht. (67) Ich möchte das so zusammenfassen: Aus der Sicht der Ethik, in deren Pragmatik Treu und Glauben, Lüge und Wille zur Wahrheit, zusammengefasst die „Glaubwürdigkeit“, zentral ist, bleibt die Authentizität eines Objekts ein abgeleitetes Postulat.
In der Praxis genügt Martin Fröhlichs Faustregel für alle Eingriffe in ein Bau- und Kunstdenkmal und überhaupt für Eingriffe in ein Bauwerk: „Sowenig wie möglich, soviel wie nötig!“
Was aber gebietet die Ethik, wenn sich ein vollständiger Ersatz des Bau- oder Kunstdenkmals aufdrängt?
(Abbildung 34) Als Beispiel präsentiere ich die Gerechtigkeitsstatue des Berner Gerechtigkeitsbrunnens, von der im Kapitel über Pietät bereits unter dem Gesichtspunkt der Emotionalität die Rede war; denn Emotionen, so wollte ich zeigen, können bald zur Denkmälerzerstörung, bald zur Denkmälererhaltung führen. Im Kapitel Authentizität geht es um etwas anderes.
Die Brunnenfigur der Gerechtigkeit hat sich nämlich verdoppelt. Als 1986 die ursprüngliche Gerechtigkeit von ihrem Sockel gestürzt wurde und in tausend Stücke zersprang, wurden diese sorgsam gesammelt und in minutiöser Arbeit zusammengesetzt. Anschließend wurden alle Anstriche bis auf die Steinhaut entfernt, um eine Kopie anfertigen zu können. Andernfalls wäre diese zu teigig geworden. Die nach damaliger bernischer Doktrin von Stein gehauene Kopie wurde auf der Brunnensäule aufgestellt und so bemalt, wie das Standbild zuletzt bemalt gewesen war; das zusammengeflickte Original kam ins Historische Museum und wurde steinsichtig belassenen. Die Entscheidung traf der zuständige städtische Denkmalpfleger Bernhard Furrer. Ich behaupte nun und rechtfertige damit seine Entscheidung:
Nach verbreiteter Meinung lässt sich das Denkmal durch die Kopie ersetzen, das Kunstwerk aber erträgt nur die notwendigste Ergänzung. Differenzierter ausgedrückt: nicht jede Eigenschaft des Denkmals verlangt nach Authentizität.
Mit der Kopie wurde natürlich nicht das Denkmal als Objekt geheilt, wohl aber die Beleidigung durch den Denkmalsturz, der bald fast ganz aus dem Bewusstsein derer entschwanden, die ihn erlebt hatten. Für wache ältere Zeitgenossen mag die Kopie auf der Brunnensäule ein Zeichen der Versöhnung nach erlittener Schmach sein. In dieser Sicht ist die Brunnenfigur nicht ein Denkmal der Geschichte, sondern ein Anlass der Erinnerung, auch wenn diese mittelbar oder unmittelbar von der Geschichtsschreibung gespeist wird. Puristen erklärten damals, 1986, der denkwürdige Denkmalsturz müsse durch eine leere Brunnensäule erinnert werden.
Als museifiziertes Objekt hat die Brunnenfigur der Gerechtigkeit einen anderen Status erlangt. Wie sollte man im Bernischen Historischen Museum mit dem geleimten und gekitteten Original umgehen? Einerseits wird dieses heute durch den neuen Kontext in der Nachbarschaft anderer originaler Brunnenfiguren der Stadt Bern vermehrt als Dokument wahrgenommen, andererseits macht die Präsentation auf einem aus Stahlbalken und Stahlplatten geschweißten Sockel das Original vorrangig zu einem Kunstwerken mit ästhetischen, typologischen und ikonografischen Qualitäten. Die Steinsichtigkeit lässt die unzähligen Kittstellen sehen und dokumentiert so seinen Sturz. Die Neubemalung im Sinne des ursprünglichen Zustandes wurde zwar vonseiten des Konservators im Museum angeregt, scheiterte aber sowohl am Status der Skulptur als Dokument als auch am überaus lückenhaften Befund der Farbuntersuchung.
In einem größeren Zusammenhang gesehen sind Steinskulpturen im Freien stärker durch die Unbilden der Witterung gefährdet als durch die vielfältig motivierten Denkmalzerstörungen. Eine große Gruppe bilden die Statuen der romanischen und gotischen Figurenportale wie die der Stiftskirche von Saint-Ursanne und des Berner Münsters, um nur zwei schweizerische Beispiele zu nennen. Die Entscheidung, die Brunnenfigur der Gerechtigkeit ins Museum zu verbringen, wurde dadurch erleichtert, dass dies schon früher mit einem Drittel der Berner Brunnenfiguren geschehen war, und mehr noch durch die damals gerade abgeschlossene Museifizierung der Bildwerke vom Jüngsten Gericht am Hauptportal des Münsters. Auf welche Art dann die Museumsleute dieses Skulpturenensemble wiederum zu einem Jüngsten Gericht vereinigt haben, steht auf einem anderen Blatt. (68)
(Abbildung 35) Kehren wir zur Architektur zurück! Was sagen uns die Grundsätze der Ethik in Fällen wie der Kapellbrücke von Luzern, der Brücke von Mostar, der Brücke von Büren an der Aare und der Frauenkirche von Dresden, alle nach 1990 wiederaufgebaut?
Die drei Brücken wurden nach ihrer Zerstörung rasch wiederhergestellt. Anders die Frauenkirche in Dresden: sie wurde erst nach einer Pause von 60 Jahren rekonstruiert.
Von den Brückenbeispielen betrachten wir allein die Brücke von Büren an der Aare. Holzbrücken sind durch Hochwasser und Konflikte gefährdet; nicht selten werden sie auf Feldzügen in Brand gesteckt. Die jetzige gedeckte Holzbrücke in Büren ist bereits die neunte. Die achte von 1821/22 wurde 1989 durch Brandstiftung zerstört, offenbar in der Absicht, den Bau einer neuen verkehrstauglicheren Brücke zu forcieren. Die neue Holzbrücke ist ein Kompromiss. Sie nähert sich dem alten Erscheinungsbild, wurde jedoch nach neuer Technologie mit einer Betonfahrbahn errichtet. Das Fachwerk besteht aus Brettschichtholz. Die Länge von 105 m ist in fünf Joche unterteilt, deren größte Spannweite 35 m beträgt. Die Durchfahrt unter der Brücke wurde um 30 cm erhöht, um die Schifffahrt bei hohem Wasserstand zu ermöglichen. Der Wagenverkehr wird durch eine Lichtanlage geregelt.
Beim Bau der Ersatzbrücke verfolgte der damalige kantonale Denkmalpfleger Jürg Schweizer drei Ziele: 1. die Wiederherstellung eines Wahrzeichens, 2. die Wiedergutmachung eines Unrechts, 3., obgleich nur indirekt, die Erhaltung der schmalen Zufahrt als städtebaulich wichtiges Merkmal. Diesen drei Zielen genügt die heutige Brücke vollauf. (69) Die Frage übrigens, ob die neue Brücke unter Denkmalschutz zu stellen sei oder nicht, ist keine ethische, sondern eine rein administrative Frage.
(Abbildung 36) Und nun zur Frauenkirche in Dresden! (70)
Der Erinnerungswert, ich könnte auch sagen, die Eigenschaft des Denkmals als Denkmal, erheischt nicht in demselben Maß Authentizität wie die Eigenschaft als historisches Dokument oder als Kunstwerk. Das Entscheidende ist der Eindruck der Kontinuität. Der Wiederaufbau eines Baudenkmals nach einem Natur- oder einem Kriegsereignis vermag den Erinnerungswert weitgehend wiederherzustellen. Wann das angezeigt ist und ob die staatliche Denkmalpflege dazu Hand bieten soll, steht hier nicht zur Diskussion. Das ist eine Nebenfrage. Die Hauptfrage lautet: Ist der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden eine Geschichtsfälschung, und wenn das der Fall ist, was bezweckt sie?
Die Mehrheit der deutschen Denkmalpfleger protestierte lauthals gegen den Wiederaufbau. Warum? Ich gebe Ihnen eine Erklärung, die auf der Analyse der Debatte beruht, die geführt wurde; ich bin mir aber bewusst, von den vielen Motiven nur eines herauszuschälen.
Die deutschen Denkmalpfleger hatten die deutsche Gesetzgebung zu Denkmalschutz und Denkmalpflege im täglichen Kampf um die Erhaltung der Denkmäler so weit verinnerlicht, dass sie Bau- und Kunstdenkmäler nur noch als Zeugen oder Zeugnisse der Geschichte zu betrachten vermochten. Eine wieder aufgebaute Dresdner Frauenkirche aber würde kein Zeugnis mehr ablegen, weder vom Sachsen des 18. Jahrhunderts und seiner prächtigen Hauptstadt, noch von den Eigenheiten lutherischer Gesinnung und Gottesdienstordnung, noch von der deutschen Architekturgeschichte, noch – schließlich – vom Elend und von der Schmach der Stadtzerstörung durch den alliierten Bombenangriff vom Februar 1945. Der Wiederaufbau würde, so die Meinung der Mehrheit, eine ungeheure Lüge sein, die wieder aufgebaute Kirche eine Fälschung. Gleichwohl wurde er 1992 entschieden und 2005 vollendet.
Dem Protest aus dem Westen hielt die Seele des Wiederaufbaues, der Bauingenieur und Architekturhistoriker Heinrich Magirius, entgegen: (71)
Merkwürdigerweise nimmt die denkmalpflegerische Fachwelt weniger Notiz und Anstoß am Wiederaufbau des Dresdner Schlosses als am „archäologischen“ Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Der Grund ist wohl der, dass an ihrer Ruine selten eindrücklich der „Zusammensturz“ der Kirche gleichsam zum Symbol für den Zusammenbruch des wahnsinnigen „Dritten Reiches“ angesehen werden konnte. Vor allem auf die seit nunmehr fast Jahrzehnten an Kriegsruinen nicht mehr gewohnten westdeutschen Dresden-Besucher machte offenbar die Denkmalhaftigkeit dieser Ruine tiefen Eindruck. An das Monument Frauenkirche, den von George Bähr 1726 bis 1743 errichteten lutherischen Zentralbau mit seiner Überwölbung durch eine „steinerne Glocke“ erinnerte der Trümmerhaufen mit den ihn begrenzenden zwei „Zähnen“ im Osten und Nordwesten kaum mehr. Sein ehemaliger Monumentencharakter war aber erst recht von Bedeutung. Denn Bähr hatte auf den städtebaulichen Ausdruck seiner Frauenkirche besonderes Gewicht gelegt. Sein Kuppelbau war nicht eigentlich in der Tradition der Kuppelkirchen Italiens verankert, sondern entsprungen einer demonstrativen Haltung, einen Bau „von unten an bis oben hinaus wie einen einzigen Stein“ wirken zu lassen. Das war eine Glaubensaussage des lutherischen Dresdens in der Residenz des katholischen Kurfürsten-Königs […]. [Zur Erklärung für den Ausdruck „Kurfürst-König“: Die polnischen Adligen hatten den Kurfürsten von Sachsen 1697 zum polnischen König gewählt.]
(Abbildung 37) Den Dresdnern, die diesen Bau noch erlebt haben, war seine Erscheinung wie kein anderer ins Herz geschrieben. […] In den Wochen der politischen Wende im Herbst 1989 waren es […] Dresdner Bürger, die den Gedanken des Wiederaufbaus der Frauenkirche als Hoffnungszeichen der Versöhnung und des Friedens unter den Völkern proklamierten. […] Allerdings gab es in kirchlichen Kreisen auch erhebliche Widerstände. Ihre Argumente deckten sich etwa mit denen von Kulturkritikern im Westen Deutschlands. Sie vermochten an der Frauenkirche nur noch das Monument des Zusammenbruchs zu erkennen. Das traf sich mit Überzeugungen der gegenwärtigen Denkmalpflege, die ihre Aufgabe nur noch im Stillstellen des historisch Gewordenen sieht. So wurde die Dresdner Frauenkirche zu einer Art Prüfstein des Gewissens, wie man es am Ende des 20. Jahrhunderts in Deutschland mit den Denkmalen halten soll.
Die Rede des deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler zur Eröffnung der Dresdner Frauenkirche am 30. Oktober 2005 bestätigte die Widmung des Baues zu einem Zeichen der Versöhnung. Ich sage „Widmung“ oder „Umwidmung“ für die „Interpretation“ des nach Möglichkeit dem alten ähnlichen Neubaues, der getreuen monumentalen Kopie.
Die kirchliche Medienmitteilung von damals (72) endet freilich mit einem Zweifel:
Der Bau unter dem Leitspruch „Brücken bauen – Versöhnung leben“ wurde auch aus den USA und Großbritannien gefördert. So bezahlte etwa ein britischer Verein das goldene Turmkreuz, an dessen Herstellung der Sohn eines der Bomberpiloten der Luftangriffe auf Dresden 1945 beteiligt war. Der Gedanke der Versöhnung verlieh dem Wiederaufbau ein hohes symbolisches Prestige. Dabei wird sich erst noch erweisen müssen, ob das riesige Interesse an der neuen Kirche tatsächlich ein Signal für eine „Wiederkehr der Religion“ ist – oder nicht doch nur ein religiöser Medienevent des Jahres 2005.
So stehen wir wieder bei der Interpretation der Denkmäler, die zu deren Wertsetzung beiträgt. Die neue Frauenkirche sieht weitgehend aus wie die alte, ist aber gerade durch das jahrzehntelange Dasein der alten als Ruine gegenüber radikal neuen Interpretationen zugänglich, ohne dass aus dem Gedächtnis gelöscht werden muss, dass die alte Frauenkirche ein Opfer menschlicher Raserei geworden ist.
*
In meiner Vorlesung „Ethik der Denkmalpflege“ habe ich nacheinander behandelt: 1. den Ort der Ethik in der Systematik der Philosophie und ihren Bezug zur Praxis; 2. die Verschwendung von Kulturgut in der Wegwerfgesellschaft; 3. die Pietät als wahren Beweggrund für die Pflege der Denkmäler; 4. die Musealisierung als Holzweg im Kampf gegen Kulturverlust und Chance für neue Interpretationen der überlieferten Denkmäler; 5. und letztens die Authentizität als ethischen Prüfstein unserer Eingriffe in den Bestand sowie dessen Deutung und Wertung.
Ich habe dabei ein stringentes Argumentarium zu vermitteln versucht und dieses an Beispiele und Bilder gekoppelt. Ich bin mir jedoch bewusst, dass für rasche Entscheidungen in der Praxis nur die Faustregeln taugen.
Notes
(1) Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785); ders., Kritik der praktischen Vernunft (1788). Einen historischen Überblick über Ethik gibt Alexander Ulfig, Lexikon der philosophischen Begriffe, Wiesbaden: Fourier, 1997.
(2) Brockhaus’ Konversations-Lexikon. 14., vollst. neu bearb. Aufl. Neue rev. Jubiläums-Ausgabe, XV, Leipzig: Brockhaus, 1908, S. 36.
(3) Eine Zusammenstellung gibt Arthur Schopenhauer in seinem Werk Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften (1840), zit. nach A’ S’, Hauptwerke, hrsg. und mit einem Nachwort von Alexander Ulfig, Köln: Parkland, 2000, Bd. II, bes. S. 414 ff. und 505 ff.
(4) Ebd., II, S. 429, mit vermutlicher Quelle.
(5) Matth. 5, 43; 22, 39. Luk. 10, 27. Joh. 13, 34. Röm. 13,9. Gal. 5, 14. Jak. 2, 8. Nur Johannes bezeichnet dieses Gebot als neu, als entolhn kainhn. In der Vulgata und anderswo ist der Wortlaut nicht stets derselbe (im AT ist der Nächste „amicus“, im NT „proximus“.
(6) Ulfig 1997, S. 270 und 386.
(7) Erwin M. Diener, Die Allmacht der Materie. Von der Materie zur Selbstwerdung der Individualität, Berlin: Logos, 2005, S. 208–240.
(8) „Preisschriften“; Schopenhauer 2002, II, S. 281–546 (Fassung von 1860).
(9) Juristen unterscheiden diese beiden letzten Begriffe; siehe Oskar Adolf Germann, Über den Grund der Strafbarkeit des Versuchs (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, LIII), Diss. iur. Zürich, Aarau: Sauerländer, 1914, S. 7, Anm. 34.
(10) Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (1790), § 86–89, in: ders., Schriften zur Ästhetik und Naturphilosophie. Text und Kommentar, hrsg. von Manfred Frank und Véronique Zanetti, 3 durchpag. Bde., (surkamp taschenbuch wissenschaft), Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001, II, S. 823–848.
(11) Schopenhauer 2000, II, S. 483.
(12) Ebd., II, S. 491.
(13) Ebd., II, S. 498–499.
(14) Einen Katalog von Tugenden und Lastern entwirft beiläufig auch Kant, Über Pädagogik [autorisierte Vorlesungsnachschrift (1803)]. Benutzte Ausgabe: Immanuel Kant, Über Erziehung, München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1997, S. 106–107
(15) Adolf Reinle, Das stellvertretende Bildnis. Plastiken und Gemälde von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Zürich, München: Artemis, 1984.
(16) Dario Gamboni, The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, London: Reaktion Books, 1997 (auch deutsch). Brücke von Mostar: S. 49–50 (mit Abb.); Gerechtigkeitsbrunnen in Bern: S. 44–45 und 99–103 (mit Abb.). Siehe auch Bernisches Historisches Museum; Jahresbericht 1988, S. 23–24 (und Abb. S. 15).
(17) Nicht der Berner Schultheiß, wie man 150 Jahre lang glaubte. Ursula Schneeberger, „Zuo berschirmen die gerechtikeÿtt, […] un wer allen fürsten leytt. Staat, Krieg und Moral im Programm der Berner Figurenbrunnen“, in: Berns mächtige Zeit. Das 16. und 17. Jahrhundert neu entdeckt, hrsg. von André Holenstein, Bern: Schulverlag und Stämpfli, 2006, S. 157–161. Allgemeiner: Die Wasserversorgung in der Renaissancezeit (Geschichte der Wasserversorgung, Bd. 5), Mainz: Philipp von Zabern, 2000.
(18) Ethnologische Würdigung durch Pierre Centlivres, „Bouddha masqué, femme voilée“, in: Points de vue. Pour Philippe Junod, sous la direction de Danielle Chaperon et Philippe Kaenel, Paris: L’Harmattan, 2003, S. 339–355.
(19) www.news.ch/Bruecke+von+Mostar+soll+UNESCO+Welterbe+bleiben/
(20) Martin Fröhlich, Eduard Müller, Rütli, Schillerstein, Tellskapelle: Nationaldenkmäler am Urnersee (Schweizerische Kunstführer, Serie 50, Nr. 498), Bern: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 1991.
(21) Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 5, Neuenburg: Attinger, 1929, S. 748–749. Helmi Gasser, „Du stilles Gelände am See. Das Rütli“, in: Nutzen und Zierde. Fünfzig historische Gärten in der Schweiz, hrsg. von Brigitt Sigel, Catherine Waeber und Katharina Medici-Mall; Fotografien von Heinz Dieter Finck, Zürich: Scheidegger & Spiess, 2006, S. 211–213.
(22) Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (adoptée à Faro, Portugal, le 27 octobre 2005).
(23) Kant 2001, I, S. 198–199 („Von der Üppigkeit“).
(24) Zit. nach Wolfgang Braunfels, Abendländische Klosterbaukunst, Köln: DuMont, 21986, S. 297–300.
(25) Zit. nach John Ruskin, Die Sieben Leuchter der Baukunst. Übersetzt von Wilhelm Schoellermann (John Ruskin, Ausgewählte Werke in vollständiger Übersetzung, Bd. 1), Leipzig: Eugen Diederichs, 1900, S. 325–326.
(26) Henri Focillon, Lob der Hand (übersetzt von Gritta Baerlocher) Mit einer Einführung von René Huygues über Henri Focillon als Kunsthistoriker (Schriften der Concinnitas im Kunsthistorischen Seminar Basel, hrsg. von Joseph Gantner), Bern: Francke, 1958, S. 28–30; Schlusssatz in meiner eigenen Übersetzung.
(27) Focillon 1958., S. 33–34.
(28) Georg Mörsch, „Denkmalwerte“, in: Die Denkmalpflege als Plage und Frage. Festgabe für August Gebessler, hrsg. von Georg Mörsch und Richard Strobel, München, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1989, S. 133–142, Zit. S. 136–137.
(29) Filippo Baldinucci, Vocabolario toscano dell’arte del disegno, Florenz: Santifranchi, 1681. – Vgl. dazu Georg Germann, „Les dictionnaires de Félibien et de Baldinucci“, in: La naissance de la théorie de l’art en France (1650–1720). Actes du colloque franco-allemand de 1996, Paris-Nanterre, hrsg. von Christian Michel, in: Revue d’esthétique, 31/32, 1997, S. 253–258; wiederabgedruckt in Georg Germann, Aux origines du patrimoine bâti. Préface de Jacques Gubler (Collection Archigraphie Témoignages), Ollion: InFolio, 2009, S. 43–56. – Petra Helm, Christian Marty, „Wie reversibel sind restauratorische Maßnahmen“, in: Nachhaltigkeit und Denkmalpflege. Beiträge zu einer Kultur der Umsicht, hrsg. von Marion Wohlleben und Hans-Rudolf Meier (ID Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich, Bd. 24, Zürich: vdf Hochschulverlag, 2003, S. 119–126.
(30) Georg Germann, „Raffaels ,Denkmalpflegebrief‘“, in: Volker Hoffmann mit Jürg Schweizer und Wolfgang Wolters (Hrsg.), Die „Denkmalpflege“ vor der Denkmalpflege. Akten des Berner Kongresses, 30. Juni bis 3. Juli 1999 (Neue Berner Schriften zur Kunst, Bd. 8), Bern etc.: Peter Lang, 2005, S. 267–286. – Leïla El-Wakil, „Antique versus moderne au début du xvie siècle à Rome. La lettre à Léon X“, in: Leïla El-Wakil, Stéphanie Pallini et Lada Umstätter-Mamedova (Hrsg.), Études transversales. Mélanges en l’honneur de Pierre Vaisse, Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2005, S. 47–58.
(31) „Respect et piété dans la conservation du patrimoine“, in: Petit précis patrimonial, 23 études d’histoire de l’art offertes à Gaëtan Cassina, hrsg. von Dave Lüthi, Nicolas Bock, Lausanne: Edimento, 2008, S. 41–55. Wiederabgedruckt in Georg Germann, Aux origines du patrimoine bâti. Préface de Jacques Gubler (Collection Archigraphie Témoignages), Ollion: InFolio, 2009, S. 407–422.
(32) Fotomechanischer Nachdruck: Johann Martin Chladenius, Allgemeine Geschichswissenschaft. Mit einer Einleitung von Christoph Friederich und einem Vorwort von Reinhart Kosellek (Klassische Studien zur sozialwissenschaftlichen Theorie, Weltanschauungslehre und Wissenschaftsforschung, hrsg. von Karl Acham, Bd. 3), Wien, Köln, Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1985, S. 157–158.
(33) Jacob Burckhardt, Über das Studium der Geschichte. „Weltgeschichtliche Betrachtungen“, hrsg. von Peter Ganz, München: C. H. Beck, 1982, S. 107, Z. 23, S. 245, Z. 42, S. 230, Z. 18 (zum Satz „Historia vitae magistra“).
(34) Wiederabdruck: Norbert Wibiral, „Denkmal und Interesse“, in: Wilfried Lipp (Hrsg.), Denkmal – Werte – Gesellschaft. Zur Pluralität des Denkmalbegriffs, Frankfurt a. M., New York: Campus Verlag, 1993, S. 51–84.
(35) Belege für den Begriff der Pietät bei Nietzsche, Riegl und Dehio: Norbert Huse, „Bedürfnisse nach Geschichte“, in: Naturschutz und Denkmalpflege. Wege zu einem Dialog im Garten, hrsg. von Ingo Kowarik, Erika Schmidt, Brigitt Sigel (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich, 18), Zürich: vdf Hochschulverlag, 1998, S. 41–50 (S. 41). „Anderen die Quellen geschichtlicher Erkenntnis rein zu erhalten, das sei das Ziel ,tiefwurzelnde Pietät‘“, fordert Cornelius Gurlitt, Über Baukunst (Die Kunst. Sammlung illustrierter Monographien, hrsg. von Richard Muther, Bd. 26), Berlin: Bard, o. J. (1904), S. 12.
(36) Le Bonniec, H., „Pietas“, in: Lexikon der Alten Welt (unveränderter Nachdruck der einbändigen Originalausgabe von 1965), 3 Bde., Zürich, München: Artemis Verlag, 1990, Bd. 2, Sp. 2328.
(37) Ich benutze die Ausgabe von Fritz Mende, Berlin: Rütten & Loenig, 1986, S. 310–311.
(38) Das Folgende nach Paul Booz, „Das Münster und seine Gefährdung im Wandel der Zeiten“, in: 75 Jahre Münsterpflege. Freiburger Münsterbauverein 1890–1965, hrsg. von Paul Booz, Freiburg: Münsterbauverein, 1965, S. 49–74 (67–68).
(39) Zum Folgenden Patrizia Schmid, „Organentnahme an Verstorbenen“, in: Uni Nova, Wissenschaftsmagazin der Universität Basel 103, Juli 2006, S. 33-34 (Zusammenfassung der Diss. iur. Univ. Basel).
(40) „Das Recht auf Exhumierung“ (sda), in: Der Bund, 14. Juli 2006, S. 7.
(41) Besonders eindrücklich: Jean-Michel Leniaud, L’Utopie française. Essai sur le patrimoine. Préface de Marc Fumaroli, Paris: Mengès, 1992. – Zum Bürgersinn: Laurent Ferri, „Les intellectuels s’intéressent-ils au patrimoine monumental et architectural? Un siècle de pétitions en France“, in: Livraisons d’histoire de l’architecture, Nr. 5, 1. Semester 2003, S. 129–162.
(42) Das ist das Thema von El-Wakil 2005.
(43) Von Kaiser Karl IV. bis zum Konzentrationslager Theresienstadt in und um Prag: Georg Germann, Cecilia Hurley, Klaus Merten, „ National Monuments: the Case of Prague“, in: Centropa. Journal of Central European Architecture and Related Arts, 7, Nr. 1, Januar 2007, S. 5–19.
(44) Eva Sturm, Konservierte Welt. Museum und Musealisierung, Berlin: Reimer, 1991, S. 107, mit Berufung auf Bazan Brock.
(45) Germann, Georg, „L’histoire aux musées d’histoire“, in: Bernisches Historisches Museum, Jahresbericht 1986, Bern 1987, S. 55–60. Museum und Denkmalpflege, Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM- und ICOMOS-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz vom 30. Mai bis 1. Juni 1991 am Bodensee, hrsg. von Hermann Auer, München etc.: K. G. Saur, 1992, S. 138.
(46) André Meyer hat ihn 1997 in seinem Vortrag zur Eröffnung des Denkmalpflegestudiums in Bern zitiert.
(47) Beide Zitate nach Sturm (wie Anm. 37), S. 14.
(48) Ebd., S. 25.
(49) Ebd., S. 34.
(50) Baudrillard in den Fatalen Strategien (1985, S. 18), zit. bei Sturm (wie Anm. 38).
(51) Georg Germann, „ Learning from Disneyland“, in: VMS. Mitteilungsblatt des Verbandes der Museen der Schweiz, 52, Juni 1995, S. 28–30. Benno Schubiger, „Period Rooms als museographische Gattung. Historische Zimmer in Schweizer Museen“, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 66, 2009, S. 81–112.
(52) Eine frühere Fassung des vorliegenden Kapitels erschien unter dem Titel „Reliquienkult und Reliquiare“ in: Infobit, Informations-Zeitschrift der Hochschule für Technik und Architektur Bern, Jg. 14, 2001, Nr. 3, S. 33–37.
(53) Hier benutzt: Charles Tayor, Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995; das Kapitel 6 (S. 64–81) trägt den Titel „Abgleiten in den Subjektivismus“.
(54) Das Authentische. Referenzen und Repräsentationen, hrsg. von Ursula Amrein, Zürich: Chronos, 2009, in der Einleitung der Herausgeberin, S. 9.
(55) Ebd.
(56) Am leichtesten zugänglich in Grundsätze der Denkmalpflege, hrsg. vom [ICOMOS-]Nationalkomitee der Bundesrepublik Deutschland, München: Karl L. Lipp, 1992, S. 45–49.
(57) International Charters for Conservation and Restoration. 2nd edition with an Introduction by Michael Petzet, hrsg. von ICOMOS, München: Lipp, 2004, S. 41. Eine behutsame Ausdeutschung der Charta von Venedig bietet Alfred A. Schmid, „Das Authentizitätsproblem“, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 42, 1985, S. 3–6. Vgl. ders., „Die Charta von Venedig“, in: Denkmalpflege heute. Akten des Berner Denkmalpflegekongresses Oktober 1993, hrsg. von Volker Hoffmann und Hans Peter Autenrieth (Neue Berner Schriften zur Kunst, hrsg. von Oskar Bätschmann, Norberto Gramaccini, Volker Hoffmann, 1), Bern etc.: Peter Lang, 1996, S. 145–159.
(58) Operational Guidelines von 1980, Art. 18 „test of authenticity“. Dazu u. a.: Herb Stovel, „Notes on Authenticity“, in: Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention. Preparatory Workshop, Bergen, Norway 31 January – 2 February 1994. Workshop Proceedings edited by Knut Einar Larsen and Nils Marstein, published by Riksantikvaren (Directorate for Cultural Heritage), Norway, o. O.: Tapir Forlag, 1994, S. 101–116. Anne Meyer-Rath, „Zeit-nah, Welt-fern?“. Paradoxien in der Prädikalisierung von immateriellem Kulturerbe“, in: Prädikat „Heritage“. Wertschöpfungen aus kulturellen Ressourcen, Dorothee Hemme, Markus Tauschek, Regina Bendix (Hrsg.), Berlin: Lit Verlag, 2007, S. 147–176.
(59) „Document de Nara sur l’authenticité“, in: Nara Conference on Authenticity, November 1-6, 1994. Working Papers collected by ICOMOS, International Council on Monuments and Sites / Conférence de Nara sur l’authenticité, 1er–6 novembre 1994. Documents de travail rassemblés par ICOMOS, Conseil international des monuments et des sites, o. O. u. J., S. 121–123; meine Übersetzung aus dem Französischen.
(60) Dazu Thomas Nipperdey, „Der Kölner Dom als Nationaldenkmal“, in: Religion – Kunst – Vaterland. Der Kölner Dom im 19. Jahrhundert, hrsg. von Otto Dann, Köln: Bachem, 1983, S. 109–120.
(61) Die ICOMOS-Charta zur Interpretation und Präsentation von Kulturstätten, vorbereitet unter der Leitung der Internationalen Wissenschaftlichen Kommission zur Interpretation und Präsentation von Kulturstätten des ICOMOS, ratifiziert durch die 16. Generalversammlung des ICOMOS, Quebec (Kanada), den 4. Oktober 2008. Meine deutsche Übersetzung .
(62) Auch städtische Kleinbauten: Hannes Scheidegger, Bedrohte Kleinbauten in der Schweiz. Pro Patria Sammlungszweck 1996 „Für die Perlen der Landschaft“. Verzeichnis aller bearbeiteten Kleinbautengesuche per 1. Juni 1998, o. O. u. J. (Zürich 1998). Ausschließlich mit alpwirtschaftlichen Gebäuden befasst sich das Heft Einst vergessen – bald verschandelt, Bern: Bundesamt für Kultur, 2004.
(63) Jörn Lamla, „Athentizität im kulturellen Kapitalismus. Gedanken zur ,konsumistischen‘ Subjektformation der Gegenwart“, in: Das Authentische 2009, S. 323–324.
(64) Jean-Michel Leniaud, Fallait-il achever Saint-Ouen de Rouen. Débats et polémiques, 1837–1852, Rouen: ASI Éditions, 2002.
(65) Paris: Angé; Versailles: Librairie de l’Évêché, 1837, Zitate S. 78 und 85–87: « Conserver un édifice, ce n’est pas seulement en prévenir ou en arrêter la chute; la conservation doit avoir aussi pour objet de le transmettre, aux âges suivants, dans toute son intégrité. […] Il ne faut pas croire que nous ayons le désir ou que nous concevions la pensée d’engager l’administration à rendre à nos églises du moyen âge leur intégrité primitive, à les revêtir de leur ancienne splendeur. Non, ce qui a été une fois englouti dans les abîmes du passé est perdu sans retour. Nous demandons seulement qu’on maintienne ce qui s’est conservé, qu’on le répare de manière à lui ôter son aspect de décrépitude sans lui faire perdre son air de vieillesse qui le rend si vénérable […]; n’ayons pas la prétention, à moins que quelque grande nécessité ne le commande, de terminer une œuvre que le siècle qui l’a enfantée a laissée imparfaite […]. »
(66) Über beide mein Aux origines du patrimoine bâti, Ollion: Infolio, 2009, S. 347–386.
(67) Darüber kartesianisch klar der Belgier Raymond Lemaire, „Authenticité et patrimoine monumental“, in: Conference on Authenticity 1994, S. 83–100.
(68) Georg Germann, „Le portail principal de la collégiale de Bern“, in: Sculptures hors contexte. Actes du colloque international organisé au Musée du Louvre par le Service culturel le 29 avril 1994, sous la direction scientifique de Jean-René Gaborit Paris: La documentation Française, 1996, S. 31–46 (Conférences et colloques du Louvre).
(69) Homepage der Gemeinde Büren und persönliche Mitteilungen des Denkmalpflegers.
(70) Heinrich Magirius, „Der Wiederaufbau zerstörter Baudenkmäler – dargestellt an der Wiederherstellung von vier Dresdner Monumenten: Zwinger, Oper, Residenzschloß und Frauenkirche“, in: Denkmalpflege heute 1996, S. 83–116. Ders., Die Dresdner Frauenkirche von George Bähr. Entstehung und Bedeutung (Denkmäler deutscher Kunst), Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, 2005, S. 7–10. Zum Thema Rekonstruktion auch die Anthologie Johannesberger Texte, 3, hrsg. von Manfred Gerner, Fulda: Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege Propstei Johannesberg, 1995, sowie die Themennummer „Rekonstruktion“ von Die Denkmalpflege 66, 2008, Heft 1.
(71) Magirius 1996, S. 96–97 und 101.
Illustrations
|
Abb. 1: Bern, Gerechtigkeitsbrunnen, um 1545, schwer beschädigt 1986 (nach Gamboni)
|
Abb. 2: Gerechtigkeitsbrunnen, restauriert
|
Abb. 3: Gerechtigkeitsbrunnen, Herrscher- büsten
|
|
Abb. 4: Mostar, Brücke, 1557, zerst. 1992, wiederaufgebaut 1995–2004
|
Abb. 5: Rütliwiese, Zustand um 1780 (Caspar Wolf)
|
Abb. 6: Rütli, Dampfschifffahrt jetzt
|
|
Abb. 7: Rütli, Projekt Karl Reichlin, 1864
|
Abb. 8: Nationalratssaal, Gemälde von Giron, 1901
|
Abb. 9: Moissac Portalvorhalle der Klosterkirche
|
|
Abb. 10: Moissac, Portalvorhalle, Westwand
|
Abb. 11: Moissac, Luxuria (Verschwendung)
|
Abb. 12: Moissac, Lazarus
|
|
Abb. 13: Cluny, Chorumgang der Klosterkirche, erbaut Ende 11. Jh., zerst. Ende 18. Jh.
|
Abb. 14
|
Abb. 15: Blosseville bei Rouen, Wallfahrtsbasilika Notre-Dame-de-Bon- Secours, 1840–1844 von Jacques Barthélemy
|
|
Abb. 16: Der Tempel Salomonis in Jerusalem im Bau,Miniatur von Jacques Fouquet (15.Jh.), für uns: Bau einer Kathedrale des15.Jh.
|
Abb. 17: Urhütte, Stich von Ch. Eisen für die 2. Aufl. von Marc-Antoine Laugier, Essai sur l‘architecture (1755)
|
Abb. 18: Rom, Tempel des Antoninus und der Faustina, 141n. Chr. (Louis-François Cassas, 1780/84)
|
|
Abb. 19: Muttergottes im Schweizerischen Nationalmuseum, Zürich
|
Abb. 20: Kölner Dom, Gerokreuz, um 960
|
Abb. 21: Kruzifix, um 1390, fotografiert 1965 in Kallern am Hausgiebel, 1977 im Schweizerischen Nationalmuseum
|
|
Abb. 22: Gerokreuz, Haupt Christi
|
Abb. 23: Nürnberg, Germanisches Nationamuseum, Plan 1860
|
Abb. 24: Nürnberg,Germanisches Nationalmuseum, Einrichtung um 1880
|
|
Abb. 25: Venedig, S. Maria Gloriosa dei Frari, Altargemälde von Giovanni Bellini, 1489
|
Abb. 26: Bern, Bernisches Historisches Museum, Teppichsaal um 1900
|
Abb. 27: Moskau, Leninmausoleum
|
|
Abb. 28: Stockholm,Skansenpark
|
Abb. 29: Bern, Bundesplatz und Spitalgasse, Globus-Umbau Fotos Martin Fröhlich
|
Abb. 30: Köln Dom 1798 und um 1990
|
|
Abb. 31: Biel, Bahnreisezentrum 2009
|
Abb. 32: Rouen, Saint-Ouen, um 1820 und um 2000
|
Abb. 33: Bern, Münster, um 1890 und um 1960
|
|
Abb. 34: Bern, Gerechtigkeitsbrunnen
|
Abb. 35: Büren an der Aare, Plan und Holzbrücke
|
Abb. 36: Dresden, Frauenkirche, um 1750 und um 1900
|
|
Abb. 37: Dresden, Frauenkirche 1996 und 2005
|